Klima
Die Lippe Lese Lounge entwickelt sich weiter! Seit Beginn des Jahres 2021 sammeln wir Texte zum Klimawandel und zur Biodiversität. Beides sind existenzielle, miteinander verwobene Themen, die auch hohe Relevanz für den EGLV haben, der die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Agenda 2030 der Vereinten Nationen unterstützt. Literarisch sind die hier zusammengestellten Texte sehr vielfältig. Von Sachtexten zu Renaturierung und Artenvielfalt über philosophische Essays, düstere Dystopien und nachhaltiges Reisen bis zum Umweltkrimi zeigen uns Autor*innen aus der Lipperegion ihre Sicht auf die größte Krise unserer Zeit.
INHALT
Hans Kratz: Ohne die Natur haben wir keine Zukunft
Dörthe Huth: Konturen, ins Schwarz verschwunden
Georg Tenger: Erhalt von heimischen Streuobstwiesen
Rosa-Parks-Schule, Herten: Wie würde Goethe ein Naturgedicht im Jahr 2084 verfassen?
Sebastian Cornelius (Klimaschutzbeauftragter Stadt Dorsten): Ein Kommentar
Hans Kratz
Ohne die Natur haben wir keine Zukunft
Einer meiner ganz persönlichen Glücksmomente in diesem Dasein gestaltet sich nach folgendem Szenario: Ich knie im Garten vor einem Beet, vertieft in irgendeine gärtnerische Tätigkeit. Außer dem Geruch der Erde, den Pflanzen um mich herum, der Sonne auf meinem Rücken gibt es da für mich nichts weiter. In dieses entspannt-sinnfreie Hantieren am Beet mischt sich unvermittelt das unverkennbare Brummen einer Hummel. Irgendwo nahe bei mir, am Kopf, hinter meinem Rücken, neben mir. Bin ich ihr lästig? Oder willkommen? Störe ich ihre Kreise? Oder wecke ich ihre Neugier? Es ist mir völlig einerlei, denn wir beide sind uns zu fremd, als dass ich mir anmaßen dürfte, zu wissen, was diese wollig, gemütliche Brummschaukel gerade empfindet. Trotzdem überkommt mich in diesem Moment stets eine tiefe Ruhe und Zufriedenheit. Es ist die Ahnung, dass wir beide in demselben sehr komplexen, weit verzweigten Netz wechselseitiger Abhängigkeiten eingewoben sind. Ein Netz, in dem jede Kreatur ihren Job macht, und zwar so, dass dieses vieldimensionale Knüpfwerk keinen Schaden nimmt.
Die Hummel tut dies, indem sie bis zu 18 Stunden am Tag (Honigbienen schaffen nur 12) von Blüte zu Blüte fliegt, Nektar sammelt und dabei sehr effizient alles, was Blüten trägt, bestäubt. Sie beginnt damit schon bei deutlich niedrigeren Temperaturen als unsere Bienen und ergänzt sich so mit diesen zu einem hervorragenden Team. Aus mehrjährigen wissenschaftliche Untersuchungen weiß man, dass Bienen, Wildbienen und Hummeln durch ihre Arbeit den Ertrag einer Obstbaumplantage im
Durchschnitt vervierfachen.
Wir Menschen sind als Organismus deutlich komplexer gestaltet und daher benötigen wir gegenüber der Hummel ein deutlich komplexeres Netz von Wechselwirkungen mit der uns umgebenden Biosphäre. Leider hat uns die Evolution diese Tatsache und die daraus sich ergebenden Notwendigkeiten weder in unser Bewusstsein noch in unser Triebverhalten geschrieben. Unsere Beziehung zur Natur ist geprägt von Gier, Dummheit und Trägheit. Oder etwas freundlicher ausgedrückt: Menschen fallt es schwer, sich selbst zu begrenzen, und es mangelt ihnen oft an Empathie anderen Arten gegenüber, vor allem jenen Geschöpfen, denen sie ihre Wildheit längst weggezüchtet haben. Der Mensch tötet sehr viel, aber nicht mehr um zu überleben, eher ist es eine Art Gewohnheitsraserei. Allein in Deutschland werden pro Jahr 650 Millionen Hühner, 53 Millionen Schweine und 53 Millionen Puten absichtlich getötet. Zukünftige Generationen werden auf diesen Umstand mit einem vergleichbaren Abscheu zurückblicken, wie wir heute auf die unsäglichen Grausamkeiten in den römischen Zirkusarenen oder während der Zeit der Hexenverfolgung.
Weil es mehr Menschen gibt und weil diese immer mehr essen, besitzen, verbrauchen wollen, braucht die Menschheit immer mehr Raum. Für Moor, Wıesenvögel, Elefanten und Thunfische bleibt folglich immer weniger Platz. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schätzen, dass alle zehn Minuten eine Art ausstirbt: Meistens unbemerkt, denn von den geschätzt neun Millionen Tier-, Pilz- und Pflanzenarten sind erst zwei Millionen wissenschaftlich beschrieben worden.
Wir haben weltweit zwei Drittel weniger Tiere als noch im Jahr 1970. Bei den Insekten sind die Zahlen im gleichen Zeitraum um mehr als 75 Prozent eingebrochen – und das allein in Deutschland. Drei Viertel der Landfläche haben wir Menschen nach unseren Bedürfnissen umgestaltet, und zwei Drittel aller Meere sind von unserem Einfluss gezeichnet. Die Fläche von Städten hat sich seit 1992 verdoppelt, die Verschmutzung durch Plastik seit 1980 verzehnfacht. Viele Populationen von Tieren und Pflanzen sind so dezimiert, dass diese auch dann aussterben würden, wenn wir sofort umsteuern würden (was wir leider nicht tun).
Zurück zu meiner Hummel, die lateinisch Bombus heißt und die mich damit an die lustigen Bommel an den Wollmützen unserer Enkelkinder erinnert. In der Dorstener Zeitung vom 03.03. 2023 las ich mit Schrecken, dass auch ihre Existenz mehrfach bedroht ist. Die Gründe: Die Zerstörung ihrer Lebensräume und Hitzestress während der bei uns immer häufiger auftretender Dürreperioden. Die Deichhummel (Bombus distinguendus), die einst bei uns sehr verbreitet war, wird sogar als stark gefährdet eingestuft. Ihr dicker flauschiger Pelz dürfet ihr in Zeiten globaler Erwärmung zum Verhängnis werden.
Laut neuestem UNO-Bericht vom 27. 10. 2022 sind wir weit von dem Ziel des Pariser Abkommens entfernt, die globale Erwärmung auf deutlich unter 2 °C, vorzugsweise 1,5 °C, zu begrenzen. Die derzeitige nationale und internationale Politik deutet auf einen Temperaturanstieg von 2,8 °C bis zum Ende des Jahrhunderts hin. Das bedeutet für Deutschland und damit auch für Dorsten eine Erhöhung der Jahresdurchschnittstemperatur um 3,6°C. In zwei von drei Sommern wird dann das Eis der Arktis verschwunden sein. 50% der Insekten werden mehr als 50% ihres Lebensraums verlieren. Trockenperioden werden in der Regel mehr als 11 Monate länger sein als heute. Die Fläche, die jedes Jahr im Mittelmeerraum Waldbränden zum Opfer fallen wird, sowie das Risiko eines Hochwasserereignisses werden sich verdoppeln. Die Korallenriffe werden vollständig ausgebleicht sein. Mehr als 50% der Weltbevölkerung wird an mehr als 20 Tagen im Jahr Temperaturen ausgesetzt sein, die gesundheitsgefährdend sind.
Das alles wissen wir, doch gefühlt ist der katastrophale Einbruch für uns eine Sache von morgen. Was ist hier und jetzt mit uns eigentlich los? Sollten wir nicht alles tun, um das anrollende Desaster so gut es geht in seiner Wirkung abzuschwächen?
Für die Hummel, die die Erhöhung der Durchschnittstemperaturen nicht zu verantworten hat, würde dies jetzt und hier zweierlei bedeuten: Die Schaffung vielfältiger Nahrungs- und Lebensräume etwa durch die Anlage von Streuobstwiesen (statt der vielen Schotterflächen in den Vorgärten) und die radikale Reduzierung unserer Konsumbedürfnisse, um den damit verbundenen CO2-Ausstoß drastisch zu senken.
Bei der Schaffung insektenfreundlicher Lebensräume sollten wir auf die Nutzung alter Sorten setzen, denn wenn Gemüse- und Zierpflanzen über Generationen in einer Gegend angebaut und vermehrt werden, passen sie sich dort an Klima und Boden an. Auf diese Weise haben lokale Sorten ihr eigenes Erbgut mit individuellen Eigenschaften entwickelt. Sie gedeihen gut im lokalen Klima und sind gegen Schädlinge und Krankheiten weniger anfällig. Diese Sorten bewahren eine große genetische Vielfalt und sind als lebendiges Kulturerbe sowie als Gen-Ressource sehr wertvoll. Alte Nutz- und Zierpflanzen müssen daher frei angebaut, vermehrt, getauscht und gehandelt werden können. Alle haben das Recht, diese Sorten weiterhin anzubauen und zu vermehren. Schmetterlinge, Bienen und Hummeln finden an den blütenreichen Stauden und Sommerblumen reiche Nahrung.
Im Grunde liegt es an uns allen. Jeder muss sich jetzt entscheiden, ob unsere Spezies auch in Zukunft noch einen Platz im wunderbaren Wirkungsnetz der Natur haben wird. Sind die Hummeln erst verschwunden, wird es für uns ziemlich eng.
Dörthe Huth
Widerstand
Wir trotzen den Elementen
und verhandeln die Polarkappen.
Jeder will Zeugnis ablegen,
niemand verzichten.
Das Meer ächzt
und verfault unter der Oberfläche.
Versprechen ertrinken im Schlamm.
Rauchsäulen hängen über den Wäldern.
Versicherungen fallen ins Vakuum.
Kein Boden wird durch Reue bewässert,
kein Feuer durch Traurigkeit gelöscht,
kein Sturm durch Verzweiflung besänftigt.
Die Elemente leisten Widerstand
und dulden keinen Aufschub.
Dörthe Huth:
Konturen, ins Schwarz verschwunden
Ein Baum, dessen Kontur sich scharf
gegen den bleischweren Himmel abzeichnet
Rinde schält sich von
berstenden Sommerzweigen
in die ausgedörrten Arme des Sommers
Erste Tropfen sollten sich ihren Weg
vom Himmel auf die Erde
bahnen, tun es aber nicht
Die schweren Wolken wenden sich
ab, stumm bleibt der Luftraum
Auf dem pulvertrockenen Boden
bildet sich die Erkenntnis
dass die Welt sich langsam
in sich selbst zurückzieht
Meine Erinnerungen können
das Gefühl von Regen auf der Haut
gerade nicht abrufen
Was also wird sich noch
über die Fläche der Zeit entfalten?
Die orange Flamme der Sonne erstickt
nach vielen lichten Stunden
Schatten fallen immer länger, bis
die Dürre ins Schwarz verschwunden ist.
Lina Stahl
Keine Hilfe
In der Dunkelheit erschien ein zertrümmerter Haufen, welcher rot strahlte.
Der Haufen schien verloren zu sein. Vertrocknete Haut. Leichenteile lagen verstreut auf ihm herum. Leichen einer vergangenen Zeit.
Die Hitze strahlte auf sie und langsam mit der Zeit passten sie sich ihrer Bestimmung an. Der warme Wind, welcher durch die Hügel streifte, verriet die Geschichte. Er verriet, wie es einst war.
Er strich die Haut entlang und folgte ausgetrockneten Betten. Tiefe Täler, wo einst Metallriesen drauf fuhren.
Pole ohne Anhaltspunkt.
Berge unzählbar jahrhundertealten Ursprungs. Sie reichten bis zur Decke.
Die zerbrochenen Wände reflektierten die Strahlen.
Vertrocknete Arme rankten sich um die Bauten.
Dieser Anblick zog sich über die ganze Haut. Die Zeit hatte die Entscheidungen, welche zu spät getroffen worden waren, überrumpelt. Diejenigen waren überrascht, doch die, die es wussten, die alles versuchten um es zu stoppen, wurden überhört, übersehen, schlicht nicht ernst genommen.
Der Geiz, der unnötige Neid, Übermacht und Papier entschied letztlich über all das, was die Mutter aufgebaut hatte. Es zog Millionen, Milliarden von Bewohnern in den Abgrund , es war zu spät.
Dieser Haufen, welcher leblos durch die Dunkelheit zieht, ist der Planet Erde.
Georg Tenger
Erhalt von heimischen Streuobstwiesen
Streuobstwiesen sind vom Menschen geschaffene Biotope und gehören seit Jahrhunderten zu unserer Kulturlandschaft. Schon seit der Römerzeit wird in Deutschland systematisch Obst angebaut. Die größte Ausdehnung des Obstanbaus auf Streuobstwiesen wurde in Deutschland um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert erreicht. Als Streuobstwiesen werden alters- und sortendiverse Ansammlungen von hochstämmigen Obstbäumen, deren Flächen meist zusätzlich als extensive Wiesen oder Weiden genutzt werden, bezeichnet. Die Bäume stehen so weit auseinander, dass jeder Baum ausreichend Platz und Licht zum Wachsen hat. Die Krone dieser Bäume beginnt erst auf einer Höhe von ca. 180 Zentimetern. Die Nutzung von Streuobstwiesen findet somit in der Regel in zwei Stockwerken statt. Im oberen Stockwerk, der Baumkrone werden die Früchte geerntet, im unteren Stockwerk wird der Grasaufwuchs durch Mahd oder Beweidung genutzt.
Streuobstwiesen liefern uns Menschen somit hochwertiges, ungespritztes Obst von alten, regionaltypischen Apfel- und Birnensorten sowie von zahlreichen weiteren Obstsorten.
Nach dem Zweiten Weltkrieg ging die wirtschaftliche Bedeutung der Streuobstwiesen immer mehr zurück: Landwirtschaft und Obstbau wurden eigenständige Betriebszweige, der Obstbau konzentrierte sich auf intensiv gepflegte Niederstamm-Plantagen.
Bald wurde der Apfel zum EU-weit standardisierten Handelsprodukt. Die Sortenvielfalt ging dabei verloren und zahlreiche Streuobstwiesen wurden sogar mit EG-Prämien gerodet. Durch das preisgünstige Obstangebot auf dem Markt ließ das Interesse an der Selbstversorgung in der Bevölkerung stark nach, die Pflege der Altbestände wurde vernachlässigt und junge Bäume nicht mehr nachgepflanzt. So sind allein zwischen Mitte der sechziger Jahre und 2005 in Nordrhein-Westfalen drei Viertel aller Streuobstwiesen verloren gegangen und nehmen heute weniger als 0,5 % der Fläche von NRW ein.
Streuobstwiesen zählen jedoch zu den artenreichsten heimischen Lebensräumen und haben daher eine große Bedeutung für die biologische Vielfalt. Viele Tiere finden hier Nahrung und einen Lebensraum. Sie profitieren von der Blütenvielfalt der Wiesen ebenso wie von saisonalen Nahrungsspitzen während der Blüte und Fruchtreife der Bäume und Weiden. Faulendes Obst, Totholz und Dunghaufen tragen ebenfalls zur Artenvielfalt bei. Von Totholz und Höhlen in Altbäumen, aber auch von künstlichen Nisthilfen profitieren viele Arten: Vögel, Fledermäuse, Hornissen und andere Insekten. Typische höhlenbewohnende Vogelarten auf Streuobstwiesen sind Steinkauz, Star, Grünspecht, Kohl- und Blaumeise, aber auch seltenere Arten wie Feldsperling und Gartenrotschwanz. Auch Säugetiere wie Haselmaus, Gartenschläfer und Siebenschläfer nehmen Höhlen in alten Obstbäumen gerne an. Fledermäuse nutzen Obstwiesen als Jagdrevier und die Baumhöhlen als Unterschlupf. Je älter die Bäume, desto höher die Artenvielfalt. Es kommt also auf eine langjährige, gute Pflege, geeignete Schnittmaßnahmen und fachgerechte Neupflanzungen an.
Für den Artenreichtum der Streuobstwiesen ist die untere Nutzung in Form von extensiv gepflegten Wiesen und Weiden von besonderer Bedeutung. So lassen sich auf Streuobstwiesen mit extensiver Unternutzung etwa 5.000 Tier- und Pflanzenarten nachweisen, darunter mehrere hundert Insektenarten. Eine extensiv genutzte Wiese sollte erst nach dem Blühhöhepunkt zum ersten Mal geschnitten werden (Mitte Juni bis Mitte Juli), ein zweiter Schnitt sollte erst kurz vor der Obsternte im September erfolgen. Für blütenbesuchende Insekten ist es besonders günstig, wenn die Wiese in Abschnitten gemäht wird und jeweils ein Teil des Blütenangebotes erhalten bleibt. Das Mähen oder Beweiden ist aber auch für andere Bewohner wichtig, denn nur im niedrigen Gras findet der Steinkauz den Käfer und der Grünspecht seine Lieblingsspeise, die Ameisen.
Eingebettet in eine strukturreiche Agrarlandschaft mit Höfen, halboffenen Feldfluren, Wegen, Teichen, Alleen und Hecken wirken sich Streuobstwiesen besonders positiv auf den Artenreichtum aus. Es sind Lebensräume aus Menschenhand und behalten ihre Qualität und ihren Wert für Natur und Umwelt nur durch regelmäßige Pflege!
Die Spezialisierung in unserer Landwirtschaft lässt heute jedoch kaum Zeit für die Pflege und Bewirtschaftung der hofeigenen Obstwiesen. Deshalb sind von Landwirten angelegte und bewirtschaftete Streuobstwiesen selten geworden. Aber auch in unseren Gärten sind immer weniger Obstbäume zu finden. Unsere Gärten werden immer kleiner und das Interesse an Obstbäumen geringer. Obst wird in Plangagen angebaut und im Supermarkt gekauft. So leiden Artenvielfalt und Qualität! Obstbäume gehören jedoch zu den bienenfreundlichsten Pflanzen im Garten. Bienen tragen in erheblichem Maße zum Erhalt von Wild- und Kulturpflanzen und deren Erträge bei. Zudem zählen die Honigbienen zu den wichtigsten Bestäubern. Ohne Bienen keine Ernte!
Am besten schmecken Obst und Saft aus dem eigenen Garten. Aber nicht jeder verfügt über einen Garten, deshalb setzen sich viele Naturschutzeinrichtungen wie die Biologische Station Kreis Recklinghausen für den Erhalt von heimischen Streuobstwiesen ein. Die Biologische Station möchte die bestehenden Streuobstwiesen im Kreis Recklinghausen dauerhaft erhalten und erneuern. Mit ihrem jährlichen Apfelsafttag, bei dem eigene Äpfel und Äpfel aus den Schutzgebieten gepresst werden, möchte sie dazu beitragen, die eigenen Früchte zu verwerten und zu genießen. Mit ihren Bildungsangeboten möchte die Biologische Station Kreis Recklinghausen insbesondere unseren Kindern die Bedeutung der Streuobstwiesen für die Artenvielfalt vermitteln.
Hierdurch hoffen wir, einen kleinen Beitrag zum Erhalt unserer Streuobstwiesen mit ihren alten Obstsorten als artenreiche, nützliche und genussreiche Kulturbiotope zu leisten.
Hans Rommeswinkel
Streuobst im Stadtraum
Die Stadt Dorsten hat Ende der 80er und zu Beginn der 90er Jahre gezielt damit begonnen Streuobstwiesen neu anzulegen. Zunächst waren es klassische Maßnahmen des Natur- und Umweltschutzes zur Verbesserung der Biodiversität im Stadtgebiet. Einige örtliche Schulen und der NABU haben Pflanzungen unterstützt und ebenfalls alte hochstämmige Obstbäume besonders im südlichen Stadtraum gepflanzt. Im Zuge der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelungen wird diese Maßnahme der Neubegrünung von Streuobstwiesen an den Baugrenzen von Neubaugebieten genutzt. Die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung bedeutet, dass bei Eingriffen in Natur und Landschaft nach einem Bewertungssystem die Schwere des Eingriffs bewertet und demzufolge der Ausgleich als sogen. Kompensations-maßnahme zum Beispiel durch das Anlegen einer Streuobstwiese erfolgen kann. Der Siedlungsrand wird somit in aufgelockerter Form gefasst und gelichzeitig bieten sich ökologische und soziale Funktionserfüllungen. Ein solches Beispiel kann gut am Schlehenweg in Rhade erkundet werden. Die Menschen entdecken diese alten Fruchtsorten oder es werden alljährlich Äpfel gesammelt und bei der Biologischen Station zu Saft verarbeitet. Aber nicht nur Apfelsorten wurden und werden gepflanzt sondern auch Birnen-, Kirsch- und Pflaumenbäumen. Diese alten Obstsorten sind im Zuge der modernen Flächennutzung und geringen Pflege der Fruchtbaumbeständen aus der bäuerlichen Feldflur verloren gegangen. Die landschaftsökologische Bedeutung der locker mit hochstämmigen Obstbäumen überstellten Wiesen ist sehr hoch, was zahlreihe Untersuchungen und Kartierungen von Tier- und Pflanzenarten belegen.
Mitte der 90er Jahre wurde die Idee in der Verwaltung geboren Brautleuten eine Möglichkeit zu bieten, einen „Hochzeitsobstbaum“ zu pflanzen. Die Verwaltung bietet dazu einen jährlichen Pflanztermin mit den Brautleuten an. So wurden im Stadtgebiet verstreut bis zur heutigen Zeit hochstämmige Streuobstwiesen als „Hochzeitwäldchen“ angelegt. Die erste dieser Fläche liegt an der Wiese nördlich der Sekundarschule in Holsterhausen. Es sind über hunderte von Bäumen von Brautleuten gespendet und selbst gepflanzt worden! Allein in den letzten 2 Jahren bis heute werden über 90 solcher Bäume gepflanzt und mittlerweile gibt es in fast jedem Stadtteil öffentlich zugängliche Streuobstwiesen. Die Pflege trägt der Betriebshof Grün des Tiefbauamtes der Stadt oder wie in Lembeck und Deuten die örtlichen Heimatvereine. Mittlerweile erfolgen auch gezielte Kronenschnitte zur Erhaltung der Bestände. Der Aufwand ist nicht unerheblich und es gibt Paten zur Unterstützung wie z. B. der örtliche Jagdhegering der Herrlichkeit Dorsten.
Aktuell wird auch erörtert, ob es auch andere fruchttragende Gehölzanpflanzungen für Geburten und Brautleute geben kann, da die Verfügbarkeit von größeren Flächen zum Neuaufbau der Streuobstwiesen erschwert ist.
Rosa-Parks-Schule Herten
11.2 (Schuljahr 2021/22) Deutschlehrerin: Kristin Hillgruber Referendar: Maximilian Julian Kubelt
Wie würde Goethe ein Naturgedicht im Jahr 2084 verfassen?
Wie trüb erscheint
Mir die Nacht
Wie eintönig ist
Diese ganze Stadt
Wie verändert sind
All die Menschen
Nur noch Beton
Soweit das Auge reicht
Der Rasen abgelöst
Nur noch Teer und Schotter
Soweit das Auge reicht
Noch einmal will ich’s riechen
Der Geruch von Benzin
Ist alles was ich rieche vor der Türe
Und zum nächsten Feld
Fahr ich eine Ewigkeit
So sehr sehn‘ ich mir herbei
Nur eine Blume pflücken zu können
Frisch von der Erde
Doch zerstörten die Menschen alles
Sie zerstörten alles was unseren Ahnen einst so wichtig war
Und nahmen uns die Gabe
An der Natur uns zu erfreuen
Welch törichter Fehler
Sie werden es bereuen
Maja Schmidt
Wie schrecklich die Natur!
Nur die Sonne ist geblieben
Kaum seh ich eine Flur
Was hat die Menschen so angetrieben
Die Düfte der Natur
Ein Blick aus dem Fenster
Seh ich den schönen Azur.
Pinar Aydin
Die neue Natur, ist erschienen
Das war deren Ziel
Sie zerstörten diese
Jahre vergingen und alles ist weg.
Wo ist die Natur? Wo ist sie
versteckt?
Fragen lauern mir durch den Kopf.
Musste alles denn so kommen
Vermisse es von tiefster Seele
Sonnenblumen, Sonne und Regen
Such es Tag für Tag.
Werde es in Erinnerungen haben,
wird bedacht
Wo ist sie hin? Oh die schöne Natur
Es ist nicht so, wie’s mal war
Alles ist fort
So such ich es!
Denn diese Zeit ist graviert
Tief in den Herzen.
Wo die Liebe so ein, so die Luft
Vermisse diesen Geruch
Oh komm zurück, ich vermisse dich
Verletzt von uns?
So repariere ich dich
Wo ist die Natur? Wo ist sie
versteckt?
Fatma Bölükbasi
Wie schrecklich düster
Mir die Natur
Wie dunkel die Sonne!
Wie warnt die Flur
Es fehlen Blüten
Von jedem Zwerg
Und eine Stimme
Aus der Wüste
Und Feind der Wonne
Aus einer Brust
O Welt, o Mond
O Leid, o Unglück
O Hass, o Hassende
So düster trostlos
Wie eine Morgendämmerung
Aus jenen Tiefen!
Ralph Efosa Wilfred Oriakhi
Wie düster sie ist
Mir die Natur
Wie dunkel die Wolken
Wie weint die Flur
Es fallen die Blätter
Von jedem Baum
Die lachenden Kinder
Hört man kaum.
Und Trauer und Leid
In jedem Herzen
Vermissen die Zeit
Ohne Kummer und Leid
O Sonne, o Leben!
Kehre zurück
Verzeihe unsere Taten
Erfüll‘ uns mit Glück.
Mayar Al-Osman
Wir haben den Geruch noch in den Nasen,
der Geruch vom frisch gemähten Rasen,
wir konnten die Natur in ihrer besten Form begegnen,
wie konnten wir nur dieses wertvolle Juwel hergeben?
Wir müssen auf unsere CO2 Emissionen achten,
doch wie sollten wir das ganze gestalten?
Sollten wir unser Verhalten beibehalten,
werden wir alle noch weinen
Cihan Cicek
Wir haben dunkel finster
Mir die Stadt
Wie schauern die Wolken
Wie lacht keine Natur
Es blenden Fenster
Von jedem Haus
Und tausend Wolkenkratzer
Aus der Stadt
Und Not und Leid
Aus jeder Brust
O grün, o wei
O Natur, o Brei
O Hass, o Leid
Wie dunkel finster
Kann die Welt sein
Karim Siala
Oh große Qual was hier zu seh’n
Selbst Opfer und Narren könn’s nicht versteh’n
Die Hoffnung ließ man in der Ecke steh’n
Oh wie sehr die Zeit und Natur vergeh’n
Oh wie idyllisch war der nasse Regen
Leichte Küsse brachten mich zum Erregen
Die Natur ist vergangen es gibt keine Wege
Oh wie schön war es im Grün sich hinzulegen.
Und der Wille des Individuums ist erloschen
Der moderne Sieg hängt an ihm wie Broschen
Wie kann man nur mir ist nicht gewisse
Man kann nur noch auf das Beste hoffen.
Paul Schulz
Die grausame Welt
Oder doch die Personen
Du denkst du wärst Held
Ohne einen Thron.
Merkst du nicht selbst
Wie grausam du bist
Die heutige Natur
Ist einfach nur Mist
So ekelig und grau.
Schlimmer als der Bau.
Was haben wir gemacht
Die Natur ohne Pracht.
Die Straßen sind laut
Voller Autos und Rauch.
Die Natur ist weg
Was für ein Schreck
Keine Vögel, nichts Grünes
Man dachte es wäre was Wunderschönes.
Omer Nassr Al den
Ich sitze hier auf diesem Dach
Unter mir ich höre nur Krach.
Alles aus Beton und Plastik
Und alle sind immer hastig.
Ach denke ich oft an die Vergangenheit,
wich zwischen Bäumen gespielt hab in meiner Freizeit.
Klettern war anstrengend doch für die Baumkronen
Sollte es sich jedes Mal lohnen,
heut ist alles von Menschen zerstört,
was mich ziemlich empört.
Alles trist und grau
Schrumpfen sich die Menschen die Natur, mit ihrem eigenen Klau.
Lenn Weidner
Ach, ach, ach die Menschheit
Wenn sie nur wüsste, ihre Natur, ihre
Schönheit und Notwendigkeit.
Wie sehr ich es vermisse
Diese Sicht
Unter der Sonne blendet mich das Licht
Ich hoffe die Natur wird sich richten.
Mohamed Ali
Bernd Saalfeld
Weltreise
Achtung an Gleis 3! Es hat Einfahrt der Intercity Rembrandt von Frankfurt nach Amsterdam. Planmäßige Abfahrt um 10.03 Uhr.
Der junge Mann mit dem strähnigen langen Haar schaut unruhig auf die Uhr. Er schiebt seinen Rucksack, der mit beiden Traggurten auf der linken Schulter hängt, zum wiederholten Male hoch. Als der Zug ein wenig später einläuft, öffnet er ungeduldig die Tür, lässt nur widerwillig den älteren Fahrgast mit dem Aktenkoffer aussteigen, drängt sich hinein, bleibt an der geöffneten Tür stehen und springt – Achtung an Gleis 3! Der Zug fährt ab! ‑ zurück auf den Bahnsteig. Mit einem kleinen Seufzer lässt er sich auf einer Bank nieder, zündet eine Zigarette an, steht gleich wieder auf, schaut hastig auf den aushängenden Fahrplan und verschwindet in der Unterführung.
Achtung an Gleis 5! Es hat Einfahrt der Intercity Gutenberg von Würzburg nach Hamburg. Planmäßige Abfahrt um 10.11 Uhr.
Die vielfach gepiercte Jeansjacke mit dem blonden Schopf darüber wird auf den Bahnsteig gespuckt, hinterlässt eine kleine Rauchwolke, die sich im Untergrund auflöst. Kaum hält der Zug, reißt der junge Mann eine Tür auf ‑ kein Reisender versperrt ihm diesmal den Weg ‑ er springt hinein, läuft in den Gang, man sieht ihn schattenhaft hinter jedem Fenster, schon verlässt er den Waggon durch die nächste Tür. Mit schnellen Schritten eilt er den Bahnsteig entlang in Richtung Wagenmitte, ein Pfiff ertönt, eine grüne Kelle wird geschwungen, fast zärtlich streicht er über die Zuglaufanzeige, mit einem langen Blick schaut er dem schnell Fahrt aufnehmenden Intercity nach.
Achtung an Gleis 8! Es hat Einfahrt der Alpenexpress von Dortmund nach Oberstdorf. Planmäßige Abfahrt um 10.19 Uhr.
Jetzt hängt der Rucksack fest auf beiden Schultern, schwingt nur leicht auf und ab, als der junge Mann seine Turnschuhe fliegen lässt, fast gleichzeitig die eine Treppe hinabstürzt, sich die nächste hinaufschwingt. Während noch das Wagengespann mit kreischenden Rädern die letzten Meter Bremsweg zurücklegt, läuft er neben einer Tür, drängt sich durch die Wartenden, einen Finger schon am Türöffner. Dann gibt die geöffnete Tür einen Schwall von Reisenden frei, nur kurz stutzt er, nimmt zwei, drei Koffer an, die er achtlos hinter sich stellt, tritt zurück, sieht das sich in die Arme fallende Paar. „Papa! Papa!“, ruft ein kleiner Knirps. Und schon setzt sich der Zug anfangs schwerfällig, schließlich immer schneller in Bewegung. Er winkt hinterher.
Auf dem Nachbargleis fährt ein Nahverkehrszug ein. Eine Schulklasse hat ihr vorläufiges Ziel erreicht, lässt sich von ihrem bemühten Lehrer nur langsam zum Ausgang treiben, grinsend beobachtet von dem langhaarigen Blonden, der sich offensichtlich noch gut seiner nicht allzu lange zurückliegenden Schulzeit erinnert. Genüsslich öffnet er eine Coladose, die er seinem Rucksack entnommen hat, und gönnt sich eine kurze Verschnaufpause auf seiner langen Reise.
Achtung an Gleis 4! Es hat Einfahrt der Intercity Louvre von Dortmund nach Paris Gare du Nord. Planmäßige Abfahrt 10.43 Uhr.
Längst hat sich der so lässig gekleidete Bursche in Position gebracht, er wirkt jetzt ruhiger, gespannter zugleich, ist sich seines Zieles sicher. Er steigt, misstrauisch beobachtet von einem Bundespolizisten, in den Waggon, setzt sich gleich in das erste Abteil, und gerade, als der Zugbegleiter selbst in den anrollenden Zug steigen will, springt er hastig wieder aus der Tür, wird von jenem mit einem groben Fluch bedacht und von dem Mann mit dem schräg sitzenden Barett angesprochen, der ihn vorher schon mit skeptischer Miene beäugt hat. Dessen Vorhaltungen schüttelt er ab wie auf die Schulter fallendes Laub: „Hey, Mann, immer cool bleiben! Ich hab vergessen, die Fahrkarte zu kaufen.”
Und damit steigt er für heute zum letzten Mal hinab in die Bahnhofskatakomben, wechselt zu Gleis 7 und vertraut sich mutig der bereitstehenden Regionalbahn 33 an, die ihn in etwa 10 Minuten aus der weiten Welt in seine Heimatstadt Dorsten zurückbringen wird.
Werner Markus
Pastors Hütte
Unser Pastor legte sehr viel Wert auf Jugendarbeit. Neben regelmäßigen Gruppenstunden im Jugendheim der Gemeinde, wurden auch Ferienlager und Wochenendfahrten durchgeführt. Unterstützt wurde er von Gruppenführern, die aus älteren Jugendlichen oder jungen Erwachsenen bestanden.
Eines Tages machte unser Pastor eine größere Erbschaft. Von diesem Geld kaufte er eine Hütte im Sauerland mit dem Gedanken, daraus ein Ferienhaus für seine Jugendgruppen zu machen. Die Hütte lag mitten im Wald, weitab von der nächsten Ortschaft. Strom und Wasser gab es nicht. Geheizt wurde mit Heizöl, welches wir in Kanistern mitbrachten. Für die Beleuchtung waren in der kleinen Küche und im Wohnraum Gaslampen unter der Decke angebracht, die jedoch nur selten genutzt wurden. Dafür sorgten Petroleumlampen für ein stimmungsvolles Licht. Es gab sogar Strom. Aber dazu mussten wir in einem Schuppen, welcher ein Stück weit vom Haus entfernt war, einen Dieselgenerator starten. Das war leicht gesagt. Mit einer Kurbel wurde er angeworfen. Besonders bei niedrigen Temperaturen war der Motor bockig und es bedurfte mehrerer Versuche und viel Kraft, bis er endlich mit lautem Getöse ansprang.
Eine abenteuerliche Konstruktion war die Wasserversorgung. Vor dem Haus war ein Brunnen, der fast (!) immer Wasser führte. Von diesem Brunnen führte eine Rohrleitung durch den Keller und durch das Erdgeschoss bis auf den Dachboden, wo ein 200 Liter Wassertank installiert war. Von hier aus wurden über Wasserleitungen die Küche und der Keller mit Wasser versorgt. Aber die 200 Liter Wasser mussten erst einmal hochgepumpt werden. Mit einer Handpumpe!!
Die Hütte war schon einige Jahrzehnte alt und der Vorbesitzer hat nicht viel Wert auf Reparaturen gelegt. Wenn wir mit unseren Freunden zur Hütte fuhren, bekamen wir immer eine Liste mit, auf der die dringendsten Arbeiten aufgeführt waren. So machten wir uns nützlich und legten immer einen Arbeitstag ein.
Der größte Luxus war die Sauna im Keller. Aus alten Fußbodenbrettern waren der Schwitzkasten und die Sitzbänkezusammengezimmert. Der Saunaofen war ein ausgedienter Ölofen mit zwei Brennkammern. Der Tank wurde ausgebaut und im Vorraum installiert. Durch eine dünne Kupferleitung wurde das Heizöl in die Brennkammern geleitet. Der Hohlraum, der durch den fehlenden Tank entstanden war, wurde mit Steinen aufgefüllt. Ein Probelauf ergab: der Ofen zieht nicht. Es lag daran, dass der kleine Saunaraum nicht genug Sauerstoff hatte. Abhilfe schafften eine Autobatterie und ein Lüftungsgebläse. Das Gebläse wurde so in die Wand eingemauert, dass es Frischluft aus dem Kellerraum in den „Schwitzkasten“ blies. Der Ofen heizte damit in kurzer Zeit die Sauna auf 100° auf.
Dieses „Luxuschalet“ nutzten meine Freunde und ich bei jeder passenden Gelegenheit. Da wir alle frisch verheiratet waren, fuhren unsere Frauen natürlich mit. So auch an einem Freitagabend im Spätherbst. Es war kalt und es regnete in Strömen, was uns nicht daran hinderte trotzdem zu fahren. Mein Freund und ich arbeiteten in derselben Firma und packten nach Feierabend schon mal das Auto. Wenig Gepäck, viel Proviant und einen Kanister Heizöl auf’s Dach. Wir waren startklar.
Nur unsere Frauen mussten wir noch abholen. Sie waren auch Arbeitskolleginnen und hatten erst um 18.30 Uhr Feierabend. Sie brauchten nur noch raus aus dem Laden und einsteigen, dann ging es los Nach zwei Stunden Fahrt in strömenden Regen kamen wir an. Der Regen ging schon in Schnee über – aber wir waren da. Zuerst wurden sämtliche Öfen angezündet. Die Hütte war total ausgekühlt. Aber nach kurzer Zeit wurde es muckelig warm. Auch der Saunaofen wurde schon mal angeheizt. Nachdem wir unser Gepäck verstaut hatten, ging es in die Sauna. Zuerst musste Wasser hochgepumpt werden, sonst gab es keine Abkühlung.
Dann endlich konnten wir in den „Schwitzkasten“ gehen. Die Saunabänke waren in zwei verschiedenen Höhen angebracht. Die obere Bank war für die ganz Harten. Dort zeigte das Thermometer über hundert Grad an. Nach kurzer Zeit lief der Schweiß in Strömen. Es wurde Zeit für einen Aufguss. Eine große Kelle Wasser wurde auf die Steine geschüttet und wie ein Hammerschlag traf uns die feuchtheiße Luft. Zum Abkühlen konnten wir nur einzeln unter die Dusche gehen. Die Regel war: raus, duschen, 20 Schläge mit dem Pumphebel Wasser hochpumpen, da der Behälter auf dem Dachboden schnell leer war und „ der Nächste“ brüllen.
Nachdem alle abgekühlt waren, gingen wir in den Ruheraum. Der Ruheraum war urgemütlich. Die Wände waren mit Rohrmatten verkleidet und für Beleuchtung sorgte eine Petroleumlampe. Das Mobiliar bestand aus mehreren Feldbetten. Wir hüllten uns in warme Decken und in Schweigen. So lagen wir eine Weile stumm auf unseren Pritschen und genossen die Ruhe. Nach zwei weiteren Saunagängen brach Jemand das Schweigen mit den Worten: „Ich habe Hunger!“ „Ich auch, ich auch, ich auch!“ war das Echo. Es war mittlerweile Mitternacht und wir hatten noch nichts gegessen. „Was essen wir denn nun?“ Gute Frage. „Pfannkuchen,“ sagte eine leise Stimme. „Jaaa, genau das,“ war die Reaktion. Also wurden mitten in der Nacht Pfannkuchen gebacken und mit großem Appetit verspeist. Satt und zufrieden gingen wir irgendwann schlafen.
Am nächsten Morgen machten wir uns an die Arbeit. Ein Graben für die neue Abwasserleitung musste ausgehoben werden. Gar nicht so einfach. Wer den Boden im Sauerland kennt, weiß, was das für eine Schufterei ist. Der Boden ist felsig und muss mit einer Spitzhacke bearbeitet werden. Unsere Frauen mussten noch dringend in die nächste Stadt Besorgungen machen. Es sah verdächtig nach Flucht aus. Aber so störten sie uns nicht und wir konnten in Ruhe weiter graben (und auch schon mal ein Bier trinken!). Nachdem auch der letzte Laden in Attendorn geschlossen hatte, tauchten unsere Mädels wieder auf.
Zeit fürs Mittagessen. Nach dem Essen waren wir faul und träge. Da der Graben ohnehin schon ausgehoben war, machten wir Feierabend. Den Nachmittag verbrachten wir lesend und quatschend im Wohnzimmer vor dem Kaminofen. Gegen Abend wurde die Sauna noch einmal angeheizt. Es war der letzte Abend in Pastors Hütte.
Am nächsten Morgen packten wir und fuhren zeitig nach Hause. Das entpuppte sich als gute Entscheidung, denn das Wetter verschlechterte sich zusehends. Auf der A45 schneite es. Hinter Dortmund ging der Schnee in Regen über und zwischen Recklinghausen und Dorsten war dichter Nebel. Aber wir hatten ein schönes Wochenende in Pastors Hütte und planten schon die nächste Tour.
Werner Markus
Camper
Camper – eine Geschichte, die in Hervest ihren Anfang nahm.
Eine turbulente Zeit lag hinter mir. Es war viel geschehen, was meine, bis dahin heile Welt, auf den Kopf stellte. Aber ich hatte noch eine Woche Urlaub aus dem Vorjahr zu bekommen. Mein Chef drängte mich, den Urlaub schnellstens zu nehmen, da er sonst verfiele.
Hannelore und ich kannten uns nun schon seit zwei Monaten und ich stellte ihr ganz vorsichtig die Frage: „Ich habe eine Woche Urlaub, den ich in der nächsten Woche nehmen muss. Ich fahre mit dem Wohnwagen, weiß aber noch nicht wohin. Hast du Lust mitzufahren?“ „Mit dem Wohnwagen? Nein! Ich habe zwanzig Jahre gegen Wohnwagenurlaub gekämpft. Beim Camping ist alles nass, kalt und schmutzig. Kleine und grosse Viecher krabbeln überall herum – nein, das ist nichts für mich“.
Ich antwortete, etwas enttäuscht: „Das ist alles Quatsch. Ich fahre aber auch alleine.“ Meine Antwort überraschte Hannelore.
Man konnte förmlich hören, wie sie überlegte: „Den? Alleine fahren lassen? Nie und nimmer nicht!“
„Wohin fahren wir denn?“ Mit dieser Antwort hatte ich nicht mehr gerechnet. „Naja, das weiß ich selbst noch nicht. Vielleicht an die Nordsee?“ „Nordsee ist gut. Was muss ich mitnehmen?“ „Das Übliche, was du sonst auch mit in den Urlaub genommen hast. Vielleicht eine Jogginganzug zusätzlich, alles Andere ist an Bord.“ „Ich brauche doch auch einen Föhn, Handtücher und Bettzeug“. „Alles an Bord!“ „Nein, Bettzeug nehme ich mein eigenes mit“. „Wenn du meinst, nimm es mit.“
Der Tag der Abreise kam. Wir wohnten noch nicht zusammen (nach zwei Monaten!). So war es nicht leicht, von Hannelores – nicht vorhandenen – Nachbarn abzureisen. Mein Plan, mit dem Caravan bei ihr vorzufahren und das Gepäck einzuladen, wurde strikt abgelehnt. Der Caravan vor ihrer Tür? Das geht gar nicht.
Also ließ ich mein rollendes Wohnzimmer auf einem Parkplatz stehen und holte sie nur mit dem Auto ab. Eine Reisetasche war ja schnell verstaut. Aber dann kam die Nummer:“ Das Bettzeug, unbemerkt von den Nachbarn, auf den Rücksitz zu packen“.
Der besondere Kick war ja, dass sie keine Nachbarn hatte! Aber Zuschauer gab es trotzdem: Kühe! Sie versammelten sich am Zaun und beobachteten neugierig unser Treiben. Dann waren wir startklar.
Auf dem Parkplatz wurde noch einmal umgeladen, der Caravan wieder an den Haken genommen und es ging los. Unser Ziel, wir hatten es uns vor dem Start aus dem Campingführer ausgesucht, hieß Westkapelle, an der Holländischen Nordseeküste. Gute 300 Kilometer lagen vor uns. Eigentlich nicht viel, aber di Landschaft sieht überall gleich aus und die Fahrt war somit recht langweilig. Am Nachmittag standen wir endlich vor der Schranke unseres Campingplatzes. Nachdem die Anmeldeformalitäten erledigt waren, öffnete sich die Schranke und wir fuhren zu unserer Parzelle.
Zunächst hatte ich etwa eine Stunde mit Aufbauarbeiten zu tun. Die Kurbelstützen mussten ausgefahren werden, damit der Caravan gerade und sicher steht. Das Stromkabel und die Gasflasche mussten angeschlossen und der Wassertank aufgefüllt werden. Hannelore richtete den Innenraum her und die Ordnung in den Schränken um. „Hier findet man ja nichts,“ war ihr Kommentar zu meiner Frage: „Warum?“ Ich habe immer alles gefunden. Aber mir war es auch egal, ob die Gabeln links oder rechts in der Schublade liegen. Das Ergebnis der neuen Ordnung war, dass ich nichts mehr wieder finden konnte.
Allmählich bekamen wir Hunger. Aus dem mitgebrachten Proviant bereiteten wir uns ein Abendessen zu. „Was trinken wir denn zum Abendessen?“ fragte Hannelore. „Wein, bot ich an.“ „Wo willst du denn jetzt noch Wein herbekommen?“ „Aus meinem Weinkeller“. Ihre Blicke sprachen Bände. „Rück doch mal etwas zur Seite,“ sagte ich. Sie rutschte in die Ecke und ich hob das Sitzpolster hoch und den Deckel der Sitzbank an. Was möchtest du denn gerne? Rotwein von der Ahr, Weißwein von der Mosel und einen Weißherbst habe ich auch noch“, Hannelore staunte und ihre Liste mit Argumenten gegen das Campen wurde immer kürzer. Wir haben aber dann doch Tee getrunken, weil wir noch das Meer sehen wollten. Es war kühl geworden und wir nahmen unsere warmen Jacken mit. Hannelore kramte noch in ihrer Reisetasche und achtete darauf, dass ich nicht sehen konnte, was sie trieb. Dann marschierten wir los. Als wir auf dem Deich ankamen, wurde es langsam dunkel. Aber das Meer lag vor uns. Wir sahen Schiffe in der Ferne, der Wind pfiff uns um die Nase und wir waren glücklich und zufrieden.
Es war stockdunkel, als wir unseren Heimweg antreten wollten. „Einen Moment noch,“ sagte Hannelore und zog mich auf eine Bank. Sie holte eine Sektflasche und zwei Gläser, die sie die ganze Zeit in ihrem Anorak versteckt hielt, hervor. „Das ist unser erster gemeinsamer Urlaub. Darauf müssen wir doch anstoßen!“ Ich war baff. Warum bin ich nicht darauf gekommen?
Wir ließen den Korken in die Dunkelheit knallen und tranken auf unser Wohl. Leicht beschwipst traten wir den Heimweg an.
Es war dunkel, zappenduster. Wir konnten die Hand vor Augen nicht sehen. Auch nicht den Panzer, der als Denkmal auf dem Deich stand. Gesehen haben wir ihn nicht mehr, aber gespürt, als ich mit dem Kopf daran gestoßen bin. Bald sahen wir die Lichter von Westkapelle und unseren Campingplatz.
„Ist das kalt hier,“ waren das Erste, was ich von Hannelore hörte, als sie den Wohnwagen betrat. Ich schaltete die Heizung ein und wenig später war es muckelig warm. Von Hannelores Liste mit Gegenargumenten wurde wieder ein Punkt gestrichen. Wir kuschelten uns in unseren Sitzecken ein und schmökerten in unseren Büchern. Eine Flasche Rotwein stand auf dem Tisch, die langsam immer leerer wurde. Bald legten wir die Bücher beiseite und fingen an zu erzählen. Es gab viel zu erzählen, denn wir hatten ja keine gemeinsame Geschichte, so wir andere Paare in unserem Alter. Irgendwann, mitten in der Nacht, krochen wir in unser Schlafabteil.
Am nächsten Morgen gingen wir zum Duschen ins Sanitärgebäude.
Weil ich etwas früher fertig war als Hannelore rief ich ihr zu: “Ich gehe schon mal vor und mache das Frühstück fertig!“ Also holte ich Brötchen, kochte Kaffee und deckte vor dem Caravan den Frühstückstisch. Unsere Nachbarn gingen vorbei und grüßten freundlich: „Nanu, so ganz alleine?“ „noch, meine Fra…., Freun…., Bekann…..,(Mist) ist noch beim Duschen. Ach ja, haben sie keine Kinder?“ „Doch, einen Jungen und ein Mädchen. Wir haben sie bei den Omas geparkt“. Die Nachbarn sahen sich vielsagend an und schüttelten die Köpfe. Ich überlegte, was ich wohl falsches gesagt habe, aber mir fiel nichts ein.
Hannelore kam nicht. In mir keimte der Verdacht auf, dass sie sich möglicherweise verlaufen hat. Also ging ich auf die Suche. Völlig aufgelöst fand ich sie am Ende des Campingplatzes. „Alle Wohnwagen sehen gleich aus“, gab sie zu bedenken.“ Egal, jetzt wird erst mal gefrühstückt!“ Beim Frühstück erzählte ich von der Begegnung mit unseren Nachbarn. Hannelore prustete los: „Hast du wirklich gesagt, dass wir einen Sohn und eine Tochter haben?“ „Wir nicht, aber ich!“ „Ich habe unsere Nachbarn vor dem Sanitärgebäude getroffen. Sie haben mich auch nach unseren Kindern gefragt.“
„Und was hast du gesagt?“ „Zwei Jungs!“
Nach dem Frühstück ging Hannelore wieder zum Sanitärgebäude und spülte unser Geschirr. Ich machte mich auch nützlich, in dem ich unsere Oberbetten und Kopfkissen zum Lüften nach draußen über die Campingstühle legte.
Hannelore kam zurück und rief entsetzt: „Bist du wahnsinnig? Jetzt weiß jeder, dass wir nicht zusammengehören!“ Ich war sprachlos. 1. Warum weiß das jeder? 2. Ich hatte mit jedem Tag mehr und mehr das Gefühl, dass wir zusammengehören. Sollte ich mich da geirrt haben?
„Ein brauner und ein blauer Bettbezug, da fällt doch jedem auf, dass da etwas nicht stimmt.
Jedem vielleicht, mir nicht. Ich sammelte die Beweisstücke wieder ein und brachte sie in den Wohnwagen zurück. Etwas später trafen wir das neugierige Paar wieder. Sie fragten uns nach allem Möglichen. Aber dann wollten sie es genau wissen: „Wie heißen denn ihre Kinder? „Michael, Jasmin, Christian und Christian.“ „Wie, habe ich das richtig verstanden? Zwei Söhne heißen Christian?“ „Ja, wir fanden den Namen so toll, da haben wir ihn zweimal vergeben.“ Damit war die letzte neugierige Frage beantwortet.
Die Zeit an der See ging viel zu schnell vorüber. Ehe wir uns versahen, saßen wir wieder im Auto und fuhren nach Hause.
„Was macht denn deine Bedenkenliste? Fragte ich Hannelore.
„Habe ich weggeworfen. Wohin fahren wir das nächste Mal?“
Das ist jetzt über 30 Jahre her. Unser nächster Urlaub war wieder mit dem Wohnwagen. Hannelore ist inzwischen nicht nur eine begeisterte Camperin geworden, sondern auch meine Frau.
Und darauf bin ich besonders stolz!
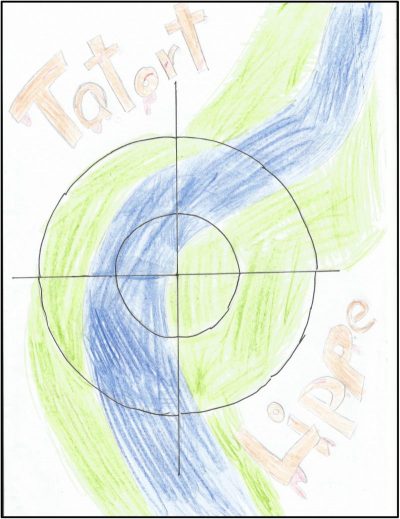
Schreibland NRW/ Stadtbibliothek Dorsten
Tatort
Ein Dorsten-Krimi
Geschrieben von:
Emma Clausen, Finn Droste, Merle Gabriele Dückers, Nele Hülsmann, Clara Kunzmann, Dana Loup, Kilian Pieck, Levje Schmadel, Simon Woitinas
Mit Unterstützung von Sarah Meyer-Dietrich
Kapitel 1: Die Familie
Es war ein lauer Abend am Ende des Sommers. Eine vierköpfige Familie saß idyllisch in einem weitläufigen Garten in Dorsten zusammen und aß ihr Abendessen. Die schöne Idylle wurde allerdings von zwei für die allgemeine Laune sehr verheerenden Sätzen der Mutter zerstört: „Euer Vater und ich müssen leider über das Wochenende eine berufliche Reise machen und sind erst am Samstagabend wieder da. Deshalb müsstest du, Elara, in dieser Zeit auf Ilias aufpassen.“
Elara, die große Schwester, stöhnte genervt auf. „Könnt ihr nicht bitte irgendeine Babysitterin für kurze Zeit einstellen?“, fragte sie mit einem absolut perfekten Hundeblick. „Ich muss doch dieses Wochenende für die Schule lernen. Da kann ich nicht auch noch auf Ilias aufpassen. Er wird mich bestimmt die ganze Zeit ablenken und fragen, ob ich irgendetwas mit ihm machen kann.“
„Es tut mir wirklich leid!“, sagte ihre Mutter. „Aber der Auftrag, den wir bekommen haben, kam spontan. Wir haben auf die Schnelle leider nirgendwo mehr eine Babysitterin oder einen Babysitter auftreiben können, und mitnehmen können wir Ilias auf gar keinen Fall. Sonst werden wir, wenn wir dort sind, direkt wieder nach Hause geschickt. Außerdem wird er dir vielleicht gar nicht so viele Probleme bereiten, wie du denkst.“ Sie wies auf Ilias, der friedlich auf seinem Stuhl eingenickt war. „Wir wollen jedenfalls, dass du auf Ilias aufpasst, und dabei bleibt es!“
„Ist ja gut“, stöhnte Elara. „Aber ich gehe trotzdem zum Recherchieren in die Bücherei.“
„Dann wäre das ja geklärt“, beendete der Vater, der anscheinend keine Lust auf die sich schnell verbreitende schlechte Stimmung hatte, die Diskussion. „Dann könnt ihr jetzt mal den Tisch abräumen, und ich bringe Ilias ins Bett.“
Kapitel 2: Elara
Ein paar wenige Schäfchenwolken treiben am Himmel. Zu klein und zu mickrig, als dass sie es schaffen würden, die Sonne zu verdecken. Ich seufze, bevor ich mich auf mein Fahrrad schwinge und entlang der Lippe zur Stadtbibliothek Dorsten fahre. Ein paar Schaumkronen schwimmen an der Oberfläche und kleine Wellen schwappen hier und da am Ufer hoch. Ich sehe eine Entenfamilie, die gegen den Strom versucht, zum Ufer zu gelangen. Eine kühle Windböe kommt mir entgegen und kündigt still das nahende Ende des Sommers an. Ich trete etwas fester in die Pedale und schließe kurz danach mein Fahrrad ab. Ich bin extra etwas schneller gefahren, um Ilias abzuhängen, der nach zwei Minuten ganz aus der Puste mit seinem blauen Minifahrrad ankommt. Er kann noch nicht so gut Fahrrad fahren und braucht immer noch seine Stützen. Zusammen gehen wir in das Gebäude, um in dem verwirrenden Ordnungssystem der Bücherei nach Büchern zum Klimawandel zu stöbern. Ich muss in der Schule darüber eine Präsentation halten.
Kapitel 3: Ilias
Ich lief in die Kinderecke und schaute mir schöne und witzige Bücher an. Aber schnell verging mir die Lust. Ich konnte die Bücher ja nicht einmal lesen. Ich bin schließlich erst sechs. Immer wieder fragte ich mich: Was finden denn alle so spannend an einer Bücherei? Mir war sterbenslangweilig. Ich wusste schon nach gut einer halben Stunde nicht mehr, was ich machen sollte, und fragte meine Schwester: „Wie lange brauchst du denn noch? Ich will nach Hause!“
Sie sagte: „Wir bleiben so lange hier, bis ich fertig bin. Und das dauert noch.
Kapitel 4: Elara
Ich entscheide mich für das Unterthema Flüsse, denn dazu finde ich eine Menge Bücher und Notizen. Die Bücherei ist erst 2038 komplett renoviert worden. Es gibt eine wundervolle Leseecke mit weichen Kissen und Lichterketten, die ein warmes Licht ausströmen, aber ich entscheide mich für einen langweilig harten und eckigen Tisch mit einem Computer und einem ungemütlichen Stuhl. So kann ich mich besser konzentrieren. Neben mir sitzt ein merkwürdig gekleideter Mann, einen Hut tief in die Stirn gezogen. Er trägt einen braunen Mantel, der für so ein gutes Wetter viel zu warm ist. Ich schüttle kurz den Kopf und atme tief durch. Ich habe mich nicht extra hier hingesetzt, um mich von den Leuten um mich her ablenken zu lassen. Ich fange an, mir ein paar Notizen zu machen. „Stürme können verantwortlich sein für Fluten. Überschwemmung.“ Ich bin froh, dass so gutes Wetter heute ist. Ich schalte den Computer ein und versuche dort noch mehr über mein Thema herauszufinden, bevor etwas an meinem Ärmel zupft. Ich drehe mich um, und es ist Ilias, der irgendetwas sagt, aber ich höre ihm nicht richtig zu, sondern nicke einfach nur, bevor er sich wieder vom Acker macht. Ich lehne mich zurück, atme durch und fange dann an, weiter über Erderwärmung und Flüsse zu lesen. Aber Ilias will mich einfach nicht in Ruhe lassen. Mal legt er den Kopf auf meinen Tisch und starrt mich schwer seufzend an, dann muss er aufs Klo und hat Angst, alleine zu gehen.
„Wie lange dauert das noch? Ich habe Hunger!“
Ich merke, dass ein Blick auf uns ruht, und drehe mich zu dem komischen Mann neben mir um, der uns lächelnd mustert, einen Schokoriegel in der Hand, den mein kleiner Bruder dankend annimmt, um ihn sich komplett in den Mund zu stecken.
Kapitel 5: Ilias
„Was macht ihr denn hier?“, fragte der Mann. Eigentlich hatte ich ihn komisch gefunden. Aber nun fand ich ihn doch nett. Immerhin hatte er mir Schokolade geschenkt.
„Sitzen in eurem Alter nicht alle zu Hause vor dem PC?“, fragte er.
Elara antwortete: „Nein, ich muss etwas für die Schule recherchieren.“
Da sagte der Mann: „Dann will ich dich nicht davon abhalten.“
„Und du beschäftige dich bitte noch ein bisschen alleine“, sagte Elara zu mir.
Ich ging genervt weg und ließ mich in der Kinderecke in den Sitzsack fallen. Ich dachte nach, was ich machen könnte. Vielleicht fangen spielen, verstecken spielen … Doch dann bemerkte ich, dass ich für alle meine Ideen jemanden brauchte, der mitspielte. Aber ich hatte ja niemanden. Meine Schwester brauchte ich gar nicht erst fragen. Dann hatte ich eine Idee: Ich würde einfach nach draußen gehen und mich mal so umschauen.
Ich lief also zu Elara und fragte, ob ich nach draußen darf, aber wie erwartet sagte sie: „Nein, ich soll auf dich aufpassen. Wenn dir etwas passiert, bekomme ich richtig Ärger mit Mama und Papa. Das will ich nicht riskieren.“
Ich ging wieder in die Kinderecke und dachte weiter nach. Mir fiel einfach nichts mehr ein, was ich hätte machen können. Ich lief in Gedanken versunken einmal durch die ganze Bücherei, Treppe rauf und Treppe runter, immer wieder.
Dann dachte ich mir: Wieso hörst du eigentlich auf deine Schwester? Sie ist doch nicht deine Mutter und hat dir nicht zu sagen, was du machen darfst. Zu dem Zeitpunkt wusste ich, dass ich jetzt einfach das machen würde, worauf ich Lust hatte, egal, was Elara zu mir sagte.
Als Elara nicht hinsah, huschte ich von Regal zu Regal, bis ich am Ausgang war. Ich wollte gerade rausgehen, da sah ich meine Schwester auf mich zurennen.
Sie fragte: „Wolltest du gerade abhauen?“
Ich sagte: „Nein, ich wollte nur etwas schauen.“
Ich ging mit meiner Schwester wieder zurück zur Kinderecke.
Gelangweilt blickte ich aus dem Fenster. Da entdeckte ich einen süßen kleinen Frosch. Ich wollte unbedingt zu ihm. Also startete ich den nächsten Anlauf. Und dieses Mal gelang es mir, aus der Bücherei zu entkommen. Ich lief gleich zu dem süßen kleinen Frosch. Er hüpfte immer wieder vor mir weg, aber ich rannte ihm hinterher. Nach ein paar Minuten blieb er stehen, drehte sich um und sagte: „Ich bin Balsamico.“
Verblüfft schaute ich ihn an und fragte: „Du kannst sprechen?“
Er antwortete: „Ja, wieso denn nicht, du kannst ja auch sprechen.“
Ich dachte, ich wäre in einem schlechten Traum. Ein sprechender Frosch! Das musste ich gleich Elara sagen. Sofort fiel mir aber ein, dass dann ja rauskäme, dass ich abgehauen war, und es würde Ärger mit Mama und Papa geben.
Balsamico fragte: „Was machst du eigentlich hier draußen so ganz alleine?“
Ich sagte: „Mir war drinnen so langweilig. Dann hab ich dich entdeckt. Also bin ich rausgegangen. Ich bin eigentlich am liebsten draußen. Deshalb will ich auch Biologe und Naturforscher werden.“
Balsamico sagte: „Komm mit, ich zeige dir etwas.“
Ich fragte: „Was ist es denn?“
„Wirst du dann sehen“, antwortete Balsamico. „Folge mir einfach.“
Nach gefühlt einer halben Ewigkeit, die ich hinter Balsamico hergeflitzt war, sagte er: „Hier wohne ich. Direkt an der Lippe.“
„Wie schön es hier ist“, sagte ich zu ihm.
Kapitel 6: Ilias
Während ich Balsamico ganz viel über verschiedene Flusstiere frage, folge ich ihm die Lippe entlang bis zu einem kleinen Wiesenstück, von wo mich schon vier andere Glubschaugen anblicken.
Da bleibt er dann einfach stehen. Zuerst bin ich etwas verwundert darüber, wieso er mich ausgerechnet hierhin geführt hat und wer die anderen Frösche sind, doch ich will unbedingt wissen, was sie mir Wichtiges zu sagen haben. Bestimmt was Cooles! Also hocke ich mich einfach mal zu ihnen ins Gras, so wie im Kindergarten bei der Morgenbegrüßung. Das kenn ich schon, von wegen ich bin nicht groß genug. Die Fröschlein verstehen mich! Da fängt Balsamico, der Laubfrosch, an, mir den Wasserfrosch und den Teichfrosch, die ich aus meinem Naturforscherbuch kenne, vorzustellen: „So, Ilias, darf ich vorstellen: meine Freunde Fukasaku und Kinoko. Ich wollte sie dir vorstellen, da du als angehender Biologe und Naturforscher unbedingt auch verschiedene Froscharten kennenlernen musst. Ist ja gar nicht so einfach, heutzutage noch Frösche an der Lippe zu finden.“

Stimmt, ich habe erst zweimal einen Frosch hier gesehen. „Wieso eigentlich nicht?“, frage ich.
Ich bekomme schnell eine Antwort, dieses Mal von dem Wasserfrosch, das muss Fukasaku sein: „Wir sind leider die letzten Froschfamilien hier an der Lippe, schon viele Freunde haben wir verloren, nie wieder gesehen. Entweder wir werden im Sommer im Wasser gekocht, wir verdursten oder trocknen aus, oder die Strömung reißt uns mit, wenn wieder einer dieser schrecklichen Regenfälle über uns hereinbricht.“
Oh nein, das wusste ich nicht, ist ja furchtbar für die Frösche, dass ihre Freunde weg sind. Wenn mein Freund Paul weg wäre, würde mich das sehr traurig machen. „Aber wieso passieren denn all die schlimmen Sachen mit euren Freunden?“
Dieses Mal meint der Teichfrosch Kinoko: „Wegen des blöden Klimawandels, ist doch klar. Was hast du denn gedacht?“
„Sei doch mal netter zu dem Jungen. Der ist doch nicht persönlich Schuld am Klimawandel“, sagt Fukasaku.
Ich bin verwirrt, was kann Kinoko meinen? „Was ist ein Klimawandel?“, frage ich.

Balsamico fängt an zu erklären: „Beim Klimawandel wandelt sich das Klima. Es wird auf der Erde immer wärmer, das weiß ich. Aber vielleicht kann Fukasaku dir erklären, was das mit uns zu tun hat, der hat von uns Fröschen am meisten Ahnung vom Klimawandel.“
Daraufhin meint Fukasaku: „Dadurch, dass es immer wärmer wird, verändert sich das Wetter in den verschiedenen Jahreszeiten sehr. Im Sommer regnet es deshalb fast gar nicht mehr und es ist total heiß und trocken, und im Winter regnet es dann ganz viel und stürmt. Im Moment ist die Lippe an manchen Stellen wie da drüben fast ganz ausgetrocknet, und das Flusswasser war letzte Woche sogar einmal 22° C warm, das haben vor allem viele Frösche und Fische leider nicht überlebt. Wir Flussbewohner sind ganz andere Umstände gewohnt. Du kannst den Boden hier ja mal anfassen, der ist total trocken. Selbst wenn es jetzt regnet, kann der Boden den Regen gar nicht aufnehmen und der Fluss tritt über die Ufer. So ist letztes Jahr unser treuer Freund Kaeru von uns gegangen.“
Das wusste ich ja alles gar nicht, ist ja schrecklich. Ich merke, wie eine kleine Träne über meine Wange kullert, gerne hätte ich Kaeru auch kennengelernt. Die Frösche nähern sich mir vorsichtig und hopsen schließlich sogar auf meine Schultern, sie wollen mich wahrscheinlich trösten. „Wieso ist Kaeru denn weggegangen, ist doch schön hier in Dorsten.“
Kinoko findet das anscheinend sehr dämlich: „Hahahhhaa! Das ist ja ein toller Forscher. Der denkt, unser Freund wäre ausgewandert oder so.“
„Kinoko!“, ruft Fukasaku, und Balsamico fügt hinzu: „Das muss doch nicht sein, mach dich nicht über Ilias lustig, er ist unser Freund. Also, Ilias: Kaeru ist im späten Herbst letzten Jahres vom Fluss mitgerissen worden und ertrunken. Wir haben ihn an der Baumgabelung gefunden, er ist gestorben.“
„Das tut mir aber leid. Und wieso gibt es den Klimawandel dann, wenn er schlecht für Frösche ist?“
„Weil seit Jahrzehnten ganz viel von dem Gas Kohlenstoffdioxid in die Atmosphäre gepustet wird“, meint Fukasaku, „das kommt vom Autofahren und Fliegen, vom vielen Baumfällen, Züchten von Tieren und zum Beispiel auch von Kohlekraftwerken. Deshalb gibt es in Deutschland mittlerweile auch gar keine Kohlekraftwerke mehr. Die sind schlecht für die Natur. Viele Menschen haben auch diese Autos von FLY, die pusten nicht so viel CO2 in die Luft, aber natürlich ist Fahrradfahren immer noch am besten.“

Auch das wusste ich nicht, muss ich gleich sofort Mama und Papa erzählen, wenn sie wieder da sind. Ich will ab jetzt jeden Tag mit dem Fahrrad zur neuen Schule fahren, dann werde ich bestimmt auch immer besser und kann demnächst Elara abhängen. Das wäre toll. „Und ihr habt den Klimawandel also überlebt. Seid ihr dann nicht ganz traurig und einsam hier als einzige Frösche der Lippe?“
Balsamico antwortet mir: „Ja, ziemlich oft sogar. Wir haben nur uns und unsere Familien, Überleben ist ein einziger Kampf, den wir allerdings gerne auf uns nehmen, um dafür zu sorgen, dass die Spezies der Frösche hier an der Lippe nicht ausstirbt. Aber wir brauchen Hilfe im Kampf gegen den Klimawandel. Von euch Menschen. Ihr müsst auch an uns Tiere denken! Es muss noch so viel getan werden, um den Klimawandel zu verlangsamen und am besten sogar zu stoppen, das kann so nicht weitergehen!“
„Ich denke an euch, ganz bestimmt, und ich erzähle meiner Schwester davon, damit sie auch an euch denken kann“, verspreche ich.
„Das ist lieb von dir, Junge“, entgegnet Fukasaku. „Wir müssen jetzt zu unseren Familien zurück, die können wir nicht so lange alleine lassen.“
Kinoko sagt: „Ja, da hat Fukasaku Recht, aber versprich uns: Tu was! Und vergiss das nie!“
„Versprochen!“
Auch Balsamico verabschiedet sich von mir: „Es war mir eine Ehre, dich kennenlernen zu dürfen. Du bist der netteste Naturforscher, den ich je getroffen habe.“
„Und du bist der Frosch mit dem lustigsten und essigsten Namen, den ich je gesehen hab, Balsamico. Schüüüüüss ihr alle!
Schneller, als ich gucken kann, sind die drei Frösche schon hinter den breitblättrigen Rohrkolben, einer Sumpfpflanze, verschwunden. Ich schaue mich um. Fukasaku hat Recht. Die Lippe ist da hinten nur noch ein dünner Strich, und viele Pflanzen sind schon ganz ausgetrocknet. Das alles ist doof für die Frösche, bestimmt wissen die Menschen alle nicht, wie schlecht es den Flusstieren geht, sonst würden die ja nicht dieses CO-Dingsbums in die Luft pusten.
Ich stehe auf und schlendere die Lippe entlang, wobei ich noch vielen netten Grashüpfern und Hummeln begegne. Tiere sind einfach mega cool, die dürfen auf keinen Fall alle von uns weggehen, das müssen wir verhindern!
Kapitel 7: Ilias
Und da ging ich. Wohin, wusste ich nicht so ganz. Zurück zur Bücherei und Ärger von Elara bekommen war jedenfalls nicht mein Plan. Ich setzte mich ins Gras und fing an, aus Stöcken und Blättern kleine Männchen zu basteln, als ich etwas Komisches hörte. Schnell versteckte ich mich hinter einem Busch, in der Hoffnung, nicht entdeckt zu werden. Eine Frau mit feuerroten Haaren sprach mit dem Mann, den wir vorhin in der Bücherei gesehen hatten. Genaugenommen hockte sie über ihm. Wollte sie ihn vielleicht auskitzeln? Sollte ich winken? Etwas blinkte in ihrer Hand. Ein Ring? Ein Messer. Wollte sie etwa Brote schmieren? Der Mann versuchte die Frau abzuschütteln. Warum? Ich hätte gerne ein Brot. Das war mir zu langweilig, und ich wollte lieber weiter Männchen basteln. Plötzlich hörte ich einen Schrei. Ich schreckte hoch und trat dabei auf einen morschen Ast, der laut knackend zerbrach. Die Frau schaute in meine Richtung. Ich blieb mucksmäuschenstill und bewegte keinen Muskel. Dann rannte sie davon. Der Mann lag auf dem Boden. Reglos. Das Wasser um ihn her färbte sich langsam rot. Eine marmeladenartige Flüssigkeit quoll aus seiner Brust. Mir wurde schlecht. Ich musste da weg. Und zwar schnell!!
Aber ich konnte mich nicht rühren. Tränen liefen über mein Gesicht. Und ich rannte. Rannte vorbei an den Fröschen, vorbei an der Wiese, auf der ich noch vorhin so nett mit ihnen geredet hatte. Ich wollte nur noch zurück zu Elara. In welche Richtung war die Bücherei? Panisch drehte ich mich im Kreis. Aus welcher Richtung war ich gekommen? Ich rannte einfach weiter in den Wald hinein. Ein Regentropfen fiel mir auf die Stirn. Es fing an zu regnen.
Kapitel 8: Elara
Ich las gerade ein Buch, das „Alles über den Klimawandel“ hieß, und machte mir Notizen, als plötzlich ein lauter und gewaltiger Donnerschlag ertönte. Ich schreckte auf und blickte mich um, denn ich wusste, dass Ilias große Angst vor Gewittern hat. Mein Bruder war nicht zu sehen. Also rief ich: „Ilias, ist alles okay bei dir?“
Keine Antwort.
Ich rief erneut.
Wieder keine Antwort.
Ich dachte mir, dass er bestimmt wieder verstecken spielen wollte, und deswegen sagte ich laut: „Ilias, gib ein Piep von dir.“
Es war kein Piep zu hören.
Langsam machte ich mir Sorgen. Vielleicht hat er sich ja mein Handy geschnappt, um vor der Tür mit Mama und Papa zu telefonieren, fiel mir ein. Also warf ich einen Blick in meinen Rucksack, doch mein Handy lag dort drinnen. Ich schaute unter Sofas, hinter Sesseln in der Leseecke, doch nirgends Ilias. Ich fragte Leute in der Bücherei, ob sie einen kleinen blonden Jungen gesehen hatten.
Bei einem jungen Mann hatte ich schließlich Glück. Er antwortete: „Ja, ich habe vorhin einen Jungen durch die Tür rausschleichen sehen.“ Er grübelte kurz und sprach dann weiter: „Ich denke, er hat irgendetwas entdeckt, weil er davor aus dem Fenster geblickt hat. Mehr habe ich dann auch nicht gesehen.“
„Okay, vielen Dank“, nuschelte ich ihm in aller Eile zu, nahm mein Handy aus dem Rucksack und flitzte zur Tür hinaus. Dabei fragte ich mich, was Ilias draußen entdeckt haben mochte. Und vor allem, was für eine große Angst er im Gewitter wohl hatte. Es ging mir so viel Schlimmes durch den Kopf. Als ich aus der Bibliothek kam, rauschte Regen auf mich herab, der sich anfühlte wie Hagel. Nun überlegte ich, wo Ilias wohl als erstes hingehen würde. Und da fiel mir die Wiese ein, wo ich mit Ilias manchmal spielte. Ich rannte zu der Wiese und hechelte dabei wie ein Hund. Ich stützte die Hände auf meine Knie, die zitterten, atmete tief ein und rannte weiter. Doch kein Ilias war auf der Wiese zu sehen. Ich hatte keine Ahnung, wo Ilias sich noch aufhalten könnte. Deshalb setzte ich mich auf eine kleine Bank direkt an der Lippe. Mir war sehr kalt und meine Füße fühlten sich wie taub an. Ich war wütend und besorgt zugleich.
„Wieso muss Ilias immer wegrennen?!“, schrie ich.
Ich nahm einen großen Stein, der neben mir lag, und warf ihn mit voller Wucht in die Lippe. Doch ich hörte kein Aufplatschen. Das Geräusch, das der Stein beim Aufprallen machte, war dumpf. Ich wunderte mich sehr, sodass ich langsam an das Ufer der Lippe ging. Ich tastete mich langsam fort. Vielleicht war hier das Wasser auch schon durch die Folgen des Klimawandels ausgetrocknet, wie ich es in dem Buch gelesen hatte. Ich nahm meinen Rucksack und zog mein Handy heraus. Ich schaltete flugs die Taschenlampe an und leuchtete dorthin, wo ich den Stein hingeworfen hatte. Ich bekam einen Schrecken und konnte mich nicht mehr bewegen.

Das konnte doch nicht wahr sein … Das, was ich vor mir sah, war unfassbar. Ich ging am matschigen Ufer in die Knie. Mein Handy rutschte mir aus der Hand und fiel ebenfalls auf den Boden. Vor mir lag der Mann, der vorhin noch in der Bücherei gefragt hatte, wieso Ilias und ich nicht wie die anderen zu Hause vor dem Computer sitzen. Er hatte eine große Schnittwunde mitten auf der Brust.
Ich war so geschockt wie noch nie in meinem Leben und erinnerte mich dann endlich an den Erste-Hilfe-Kurs, den ich einmal belegt hatte. Also presste ich beide Hände an das Herz des Mannes und drückte mehrmals hintereinander zu. Als nächstes probierte ich die Mund-zu-Mund-Beatmung. Doch beide brachten nichts. Er war tot.
„Wieso passiert immer mir so etwas?!“, schluchzte ich am Boden zerstört.
Ich wollte jetzt nichts anderes, als dass meine Eltern und Ilias mich umarmten und trösteten. Ich wollte Ilias unbedingt sagen, wie lieb ich ihn hatte. Und dass ich demnächst immer mit ihm spielen würde, wenn ihm langweilig war. Doch zuerst musste ich jetzt die Polizei rufen. Ich hob mein Handy immer noch zitternd auf, doch auf einmal fing es an zu hageln. Ich erschreckte mich so, als die harten Körner auf mich prasselten, dass mir das Handy aus der Hand flutschte. Doch leider nicht auf den Boden, sondern in die Lippe. Es sank so schnell, dass ich gar nicht versuchen konnte, es noch rauszuholen. Wie sollte ich denn jetzt Hilfe rufen? Es würde zu spät werden, wenn ich an jede Haustür klopfen und mir vielleicht niemand glauben würde. Also wollte ich zur Bücherei. Dort waren viele Leute, sodass mir bestimmt einer glauben würde. Ich sprang auf und rannte gegen den kalten Wind an. Immer wieder kamen mir Blätter entgegen. Doch ich konnte gar nicht mehr stoppen. Denn es war so, als ob meine Beine von alleine rannten und ich sie nicht mehr kontrollieren konnte.
Nun stand ich vor dem Gebäude der Bücherei. Ich sah die warmen Lichter, die in der Bücherei leuchteten, und trat schnell ein. Ich schrie in aller Eile: „Es liegt eine Leiche in der Lippe, und mein Bruder ist weg! Bitte, irgendjemand muss mir helfen!“
Kapitel 9: Emilia
Zögernd platzierte ich meinen Turm auf R2. Zittrig ließ ich die Figur los. Ich hatte schon fast gewonnen, und die nächsten Spielzüge würden zum Schachmatt führen. Ich war mit meiner Seele an dieses eine Spiel gebunden, und nichts konnte mich dazu bringen, es zu unter- oder gar abzubrechen. Außer vielleicht das eine! Das eine, was EIGENTLICH an einem Freitagnachmittag nicht passieren sollte! Aber ihr könnt es euch bestimmt schon vorstellen, dass … NATÜRLICH! … Als mein Vater seine Dame hob und schon andeutete, sie neben meinem Turm zu platzieren, was sein sicheres Ende besiegeln würde, und als meine Sehnsucht nach Sieg gerade ihren Höhepunkt erreicht hatte, begann es auf einmal schrecklich zu piepen. Ich begriff und verdrehte die Augen (eine Eigenart, die ich in letzter Zeit sehr oft zur Schau stellen musste). Allein am Klang konnte ich nämlich erkennen, dass das schreckliche Geräusch aus Papas Pieper gekommen war. Sein Beruf brachte es so mit sich, dass er in jeder Situation erreichbar sein musste, was unsere Vater-Tochter-Zeit natürlich schon früher sehr beeinträchtigt hatte und es immer noch tat. Papa sah mich wehleidig an, schüttelte entschuldigend den Kopf und ging dann in den Nebenraum, um im Revier anzurufen. Meine Augen brannten und füllten sich gegen meinen Willen mit warmen Tränen. Heute war Freitag (der Dreizehnte), und dass Freitag war, bedeutete, dass Vater-und-Tochter-Tag war. Eigentlich hatte mir mein Vater versprochen, dass er 24 Stunden für mich da sein würde. Versprechen zu halten war allerdings noch nie seine Stärke gewesen. Sogar am Altar hat er meiner Mutter einen Treueschwur gegeben, den er schon nach zehn Jahren der Liebe für eine doofe Blondine brach. Sie hieß Eleanor und war das totale Gegenteil von meiner Mum. Zum Glück konnte ich so gerade noch verhindern, dass sie gleich nach ihrer Verlobung hier einzog. JA! Mein Vater hatte ihr vor ein paar Wochen einen Antrag gemacht. Ich konnte nur hoffen, dass er ihr den Treueschwur ebenfalls brechen würde. Eine Träne tropfte unhaltbar auf das Schachbrett und breitete sich zu einer Minipfütze aus. Meine Wut stieg mir zu Kopf, schreiend warf ich das Schachbrett um und zerriss die Spielanleitung. Die Hälfte, auf der nun nur noch „Schac/Um Leben u” stand, zerriss ich noch einmal in der Mitte. Dabei schnitt ich mich am Papier. Blut tropfte von meinem Daumen auf die Küchenfliesen. Mir wurde schwindelig und ich verlor das Gleichgewicht. Fluchend ging ich zu Boden. Zuerst dachte ich, mein Vater hätte mich gehört und würde mir helfen, aber nein! Ich richtete mich wackelig wieder auf. Seit ich denken konnte, wurde mir schwindelig, sobald ich auch nur den kleinsten Tropfen Blut sah. Ich griff nach einer Packung Pflaster, die ich immer in der Hosentasche hatte. Da kam Papa endlich durch die Tür.
Als ich auf ihn zuging und gerade fragen wollte, was los war, drückte er mir etwas Geld in die Hand und erklärte: „Bestell dir was zum Abendessen. Ein Notfall … Du verstehst?”
Ich nickte. In meinem Inneren aber begann es zu brodeln, und dann kochte ich über: „WEISST DU WAS?! NEIN! ICH VERSTEHE DEIN IDIOTENDASEIN NICHT MEHR! ICH HABE EINFACH KEINEN BOCK MEHR AUF DEIN GANZES OH!-DAS-TUT-MIR-JA-SOOOO-LEID-GEBLUBBER! WEISST DU WAS?! DU HATTEST SO EINE TOLLE, PERFEKTE FAMILIE, UND DER EINZIGE BEKNACKTE GRUND, WARUM DU SIE ZERSTÖRT HAST, WAR DIESE ZUCKERWATTE VON EINER FRAU!” Schreiend zerriss ich den Geldschein in meiner Hand. „STECK DIR DEINE BLÖDEN ENTSCHULDIGUNGEN SONST WOHIN UND VERZIEH DICH!”
Weinend trampelte ich die Treppe rauf in mein Zimmer. Er hatte es verdient, mal so richtig abserviert zu werden, und mir war in dem Moment so was von egal, ob ich dafür Ärger bekommen würde oder nicht. Meine Wut war absolut gerechtfertigt. Ich hoffte nur, dass er nicht gleich zu mir ins Zimmer komme-
Weiter konnte ich gar nicht mehr denken. Schon klopfte es an meiner zugeknallten Zimmertür. Eine dumpfe, unverkennbare Stimme drang in mein Zimmer: „Es tut mir leid … Ich weiß, dass ich in letzter Zeit ein ganz schöner Idiot war … deine Mutter verletzt habe und natürlich auch dich … Aber glaub mir, für mich ist diese Zeit auch nicht gerade die beste. Ich habe deine Mutter wirklich geliebt … Aber Eleanor liebe ich auch. Man kann doch nichts für seine Gefühle. Das weißt du besser als jeder andere.”
Er schwieg. Anscheinend erhoffte er eine Entschuldigung meinerseits, aber ich wusste nicht, wofür ich mich hätte entschuldigen sollen. Ich hörte einen herzzerreißenden Seufzer, der jeden anderen aus dem Konzept gebracht hätte, aber ich hielt an meinem Plan fest, solange nicht mit meinem Vater zu reden, bis er einen plausiblen Grund gefunden hatte, warum ich das wieder tun sollte. Ich fühlte mich wie ein kleiner, hilfloser Fisch, der gegen den Strom schwimmen musste, den die anderen mit ihren durchs seichte Wasser wabernden Flossen erzeugt hatten. Dann kam mir eine Idee.
„Ich will mit!”, rief ich in den Flur. „Nimm mich mit zur Wache … Oder zum Tatort!”
Wenig später saß ich mit verschränkten Armen und überheblichem Blick neben meinem Vater auf dem Beifahrersitz. Dad knabberte voll Unbehagen auf seiner Lippe herum und versuchte mir klarzumachen, dass er mich eigentlich gar nicht mitnehmen durfte und ich mich vom Tatort fernhalten sollte, was ich aber nicht beachtete. Ich bestaunte nur die wunderschöne Fauna und Flora in der Umgebung der nahen Lippe. Die hohen Fichten am Straßenrand flogen in Lichtgeschwindigkeit an Dads Dienstwagen vorbei. Die kreischenden Polizeisirenen wurden von blinkendem Blaulicht begleitet, was ziemlich nervte. Jedes andere Kind hätte es bestimmt total krass gefunden, aber ich war schon zu einigen Notfällen mitgenommen worden. Denn ich hatte die Nimm-mich-mit-zum-Tatort-Nummer schon öfter verwenden müssen, um Dad zu verzeihen. Wirklich verziehen hatte ich ihm aber keine seiner Lügen und Missetaten.
„Hörst du mir überhaupt zu?!”, fragte er jetzt, ohne mir in die Augen zu schauen. Stattdessen tat er so, als wäre er total auf die Ampel vor uns fixiert, die gerade auf Orange wechselte und dann zu Grün überging. Dad trat so plötzlich aufs Gaspedal, dass ich in meinen Sitz gepresst wurde. Ich rümpfte beleidigt die Nase.
Plötzlich klatschte Dad sich gegen die Stirn. Als er bemerkte, dass ich das bemerkt hatte, schüttelte er nur den Kopf. „Du kannst gar nicht mitkommen …”, nuschelte er wissend. „Eine Leiche, die mit einem Messer umgebracht wurde, blutet!”
Er fing an, laut zu lachen, und ich versuchte, über dieses nicht gerade erwachsene Lachen meine Stimme zu erheben und dabei auch noch hörbar zu sein: „WAS!? EINE ECHTE LEICHE … Cool!”
Doch dann begriff ich die nicht eben zurückhaltende Schadenfreude meines Vaters … Ich konnte kein Blut sehen, was bedeute, dass ich NICHT an den Tatort mitkommen konnte. Ich seufzte. Schade. Das wäre bestimmt total der Renner in den sozialen Netzwerken geworden … Ich meine! Eine LEICHE! Frustriert den Kopf schüttelnd griff ich nach einem Straßenplan, um festzustellen, was ich machen konnte, solange mein Dad einen spannenden, gruseligen, abenteuerlichen und einfach nur mega abgefahrenen Fall zu lösen versuchte.
Als Dad nun scharf auf die Bremse trat, spannte sich der Sicherheitsgurt fest um meinen Körper und kratzte an meinem Hals.
„Sind wir schon da?“, fragte ich irritiert, denn eigentlich lag der Tatort, wie mein Vater mir schon widerwillig unter die Nase gerieben hatte, in der nahen Umgebung der Brücke, die über die Lippe in die Stadt führte.
„Nein, eigentlich nicht. Ich lasse dich nur schon einmal hier an der Bibliothek raus, damit du etwas zu tun hast, solange ich weg bin.” Er warf mir einen Blick zu, der mir schmerzhaft klarmachte, dass Dad nicht gerade unglücklich darüber war, dass ich nicht mitkommen konnte. „Außerdem muss ich hier ohnehin noch später eine Zeugin vernehmen“, fügte mein Vater hinzu.
Ich entwischte einem feuchten Kuss, öffnete die Autotür und ging, ohne mich umzudrehen, schnell durch den Regen auf die Bücherei zu. Vielleicht, dachte ich, würde ich wenigstens die Zeugin ausfindig machen können, wenn ich schon auf den Tatort verzichten musste.
Die Tür der Bibliothek stand einladend offen und bot den Besuchern Einblick in die wunderbare Welt der Bücher. Mein erster Gedanke galt den vielen Detektivromanen, die geordnet vor mir in einem Regal standen und mich magisch anzogen. Die Zeugin würde noch ein Weilchen warten müssen. Schnell war ich in einen Sherlock-Holmes-Band vertieft.
Als ich irgendwann eine Lesepause machte und den Blick durch die Bücherei schweifen ließ, fiel sie mir sofort auf. Ein mageres Mädchen, circa in meinem Alter. Sie blätterte gerade in einem besonders dicken Buch-Exemplar. Sie hatte welliges blondes Haar und um den Hals trug sie ein grünes Halstuch, das wunderbar zu ihrem Pullover passte. Doch dann bemerkte ich, wie blass sie war. Sie zitterte und hielt ihr Buch falsch herum. Ich legte mein Buch zur Seite und ging langsam auf sie zu. Ich kannte das Mädchen. Sie ging in meine Parallelklasse. Und ich war mir fast sicher, dass sie …
In diesem Moment zog mich jemand an meinem Shirt nach hinten zurück und drückte mich sanft beiseite. „Jetzt willst du auch schon meinen Beruf übernehmen, oder was?!”
Ich drehte mich erschrocken um und blickte meinem Dad direkt in die Augen.
Kapitel 10: Elara
„Also, Elara”, sagte der Polizist, der sich mir als John vorgestellt hatte, und setzte sich in einen Sessel, „ich werde dich jetzt über den Mord befragen.”
Ich nickte nervös.
„Zuallererst: Ist dir etwas an der Leiche aufgefallen?”
„Nein, außer, dass es bestimmt ein Messer war, womit der Täter angegriffen hat.”
„Okay, hast du die Leiche angefasst?”
Ich spürte, dass mein Kopf glühte. Bei dem Gedanken, dass ich einen Toten Mund zu Mund zu beatmen versucht hatte, wurde mir übel.
„Ja”, gab ich zur Antwort. „Ich habe versucht, erste Hilfe zu leisten. Aber zu spät.“
John nickte. „Dann werden wir später noch eine DNA-Probe von dir brauchen. Warum warst du eigentlich genau an dem Ort?”
„Weil ich meinen Bruder Ilias suchen wollte. Ich war mit ihm in der Bücherei und …” Ich konnte nicht mehr und fing an zu weinen. „Er ist abgehauen, und ich habe es nicht rechtzeitig bemerkt. Das ist alles nur meine Schuld. Als ich dann doch endlich bemerkt habe, dass er weg war, bin ich überall auf die Suche nach ihm gegangen. Schließlich auch am Fluss, wo ich die Leiche entdeckt habe.”
Langsam und sanft legte der Polizist mir die Hand auf die Schulter. Er sagte: „Es wird schon alles gut. Wir finden deinen Bruder und lösen dieses Rätsel.“
Ich lächelte und wischte mir die Tränen aus dem Gesicht.
„Nur noch nur eine Frage, dann hast du es geschafft”, sagte er mitfühlend. „Okay. War jemand bei dir, als du die Leiche gesehen hast?”
„Nein”, sagte ich. Zum Glück war das Verhör jetzt beendet. Da fiel mir plötzlich noch etwas ein. „Da gibt es noch etwas, das vielleicht wichtig ist“, fügte ich hinzu. „Ich habe den Toten vorher hier in der Bücherei gesehen.“
„In der Bücherei?“, mischte sich nun die Bibliothekarin ein, die von der Infotheke aus zugehört hatte. „Vielleicht kann ich Ihnen dann auch etwas über ihn erzählen. Wie sah er denn aus?“
„Durchschnittlich groß“, sagte John, „dunkelblonde Haare. Er trug einen Mantel und einen Hut.“
Die Bibliothekarin blickte John an, als hätte er ihr gerade gesagt, dass sie Witwe geworden sei. „Kenny? Kenny McAngus ist tot?! Wie kam es dazu?”
„Genau das versuchen wir ja gerade herauszufinden”, sagte John.
Die Bibliothekarin fasste sich wieder. „Ich kann helfen. Ich weiß viel über Kenny.”
John nahm wieder sein Notizbuch zur Hand, das er eben weggesteckt hatte, und sagte: „Welche Infos haben Sie denn über ihn?”
„Nun ja”, fing die Bibliothekarin an, „ich kannte Kenny sehr gut. Er war ein Journalist und arbeitete für eine Zeitung, die Kleeblatt heißt. Die Redaktion finden Sie übrigens in der Straße Sonnenweg Nummer 38. Ach wissen Sie, Kenny war so ein schlauer Mensch …”
In dem Moment kam jemand von der Spurensicherung und unterbrach: „John, wir haben hier ein elektronisches Notizbuch gefunden. Es lag bei der Lippe. Es gehört offenbar einem Kenny McAngus.”
„Danke sehr. Es gehört also dem Toten. Das werde ich mir genauer anschauen.” John packte das Buch sofort in eine der Taschen, die an seinem Gürtel hingen.
„Darf ich dann jetzt gehen?“, fragte ich.
John nickte und wandte sich wieder der Bibliothekarin zu. Ich stand auf. Ich musste weiter nach Ilias suchen. Dringend. Ich lief los und wollte gerade vorbei an dem Regal mit den Detektivromanen, als mich jemand aufhielt.
Ein Mädchen in meinem Alter schaute mich mitfühlend an. „Alles okay?“ Sie hatte schwarze Locken und dunkle Haut. Ich hielt inne und blickte sie an. Dann begriff ich. „Ich kenne dich doch. Du gehst in meine Parallelklasse. Emilia, richtig?”
Emilia nickte. „Ja, freut mich, mal mit dir ein Gespräch zu führen. Ich habe meinen Vater begleitet. Er ist der Polizist, der eben mit dir gesprochen hat. Eigentlich war heute unser Vater-Tochter-Tag. Aber, na ja … So kann ich mir zumindest einen neuen Band Die drei ??? ausleihen. Ich liebe nämlich Detektivsachen.”
„Cool“, sagte ich. „Ich interessiere mich auch für Bücher. Aber nimm mir eins bitte nicht übel. Ich kenne Die drei ??? überhaupt nicht. Worum geht es denn da?”
„Keine Sorge“, meinte Emilia. „Ich nehme es dir nicht übel. Es geht um drei Jungs. Justus, Bob und Peter. Die in jedem Band einen Fall lösen müssen.”
„Ah, verstehe.”
Nach dem Small Talk kam John zu uns. „Hi, ich muss mal kurz in die Redaktion des Kleeblatts. Ist es okay, wenn ich euch eine Weile alleine lasse?”, fragte er.
„Klar”, sagte ich.
„Kein Problem”, stimmte Emilia zu.
John nickte. „Wir werden ihn finden. Versprochen“, sagte er noch zu mir und ging dann fort.
Ilias! Das Gespräch mit Emilia hatte mich ganz davon abgelenkt, dass ich unbedingt meinen kleinen Bruder suchen musste!
„Ich muss auch weg“, sagte ich zu Emilia.
„Wohin?“, fragte sie neugierig.
„Meinen kleinen Bruder suchen“, sagte ich und merkte, dass ich wieder mit den Tränen kämpfte. „Er ist verschwunden.“
Mitfühlend schaute Emilia mich an. „Dann komme ich mit.“
Kapitel 11: John
Auf dem Weg zur Kleeblattredaktion dachte John über seine Tochter nach. Warum wollte sie denn nicht mitkommen?, fragte er sich. Eigentlich kommt sie bei so etwas doch immer gerne mit. Muss ich das verstehen? Ich glaube nicht. Sie ist irgendwie immer wieder absolut anders als am letzten Tag. Sie ist halt einfach eine sich ständig verändernde Person. Damit muss ich wohl klarkommen.
In der Redaktion angekommen ging John direkt zum Empfang, hinter dem ein älterer Mann mit schwarzen Haaren in einem braunen Sakko saß, und sagte: „Ich bin Polizist und untersuche gerade den Fall des Todes von Kenny McAngus. Wo ist denn sein Büro? Ich würde gerne in seinen Unterlagen gucken, ob es dort irgendwelche Hinweise auf Gefahren beziehungsweise mögliche Widersacher gibt. Oder wissen Sie sogar schon von irgendwem, der ihm vielleicht nicht wohlgesonnen war?“
Der ältere Mann, der, wie John an dessen Namensschild ablesen konnte, Kai hieß, antwortete: „Nein, ich weiß leider nichts von Widersachern, die Kenny hatte. Aber ist Kenny wirklich tot?“
„Ja, leider!“, entgegnete John. „Er wurde vor etwa eineinhalb Stunden an der Lippe gefunden.“
„Oh“, entgegnete Kai traurig. „Aber wer war dann vorhin hier?“, murmelte er.
John fragte: „Warum? Was war denn los?“
„Kenny war vor knapp einer Stunde hier“, antwortete Kai. „Er hat selbst noch seine Unterlagen abgeholt. Deshalb ist, glaube ich, nichts mehr da, was Sie mitnehmen könnten. Ich kann Ihnen aber grob sagen, dass er über dieses Ökostrom-Kraftwerk namens Live recherchiert hat. Mehr weiß ich auch nicht.“
„Sind Sie sicher, dass es Kenny war, der hier gewesen ist?“, fragte John. „Haben Sie mit ihm gesprochen?“
Kai schüttelte den Kopf. „Aber er trug Mantel und Hut. Sein Markenzeichen.“
„Wir haben Kennys Leiche gefunden. Er ist also ganz sicher tot. Und einen Mantel und einen Hut kann ja jeder anziehen. Also wird die Person, die vorhin hier war, wahrscheinlich sein Widersacher oder Mörder gewesen sein. Das wiederum würde ja bedeuten, dass der Mörder nicht wollte, dass Kennys herausgefundene Infos an die Öffentlichkeit kommen. Also ist jetzt im Prinzip die Frage: Was hat das Kraftwerk zu verbergen? Oder wollte der Widersacher irgendwie nur den Verdacht auf das Kraftwerk lenken und hatte stattdessen einen anderen Grund, Kenny zu töten?“, dachte John laut. „Äh … Jedenfalls vielen Dank für die Infos. Dann gehe ich jetzt besser wieder. Ich muss wohl weiter nach Hinweisen suchen, um zu gucken, welche von den beiden Möglichkeiten die richtige ist. Auf Wiedersehen und einen schönen Tag noch!“
„Gerne und danke gleichfalls“, verabschiedete sich Kai.
Kapitel 12: Emilia
Mein Blick fiel auf meine vom matschigen Grund total verschmutzten Sneaker, die noch strahlend weiß gewesen waren, als ich vor nicht allzu langer Zeit die Bücherei betreten hatte. Ich hatte für einen kurzen Moment nicht auf den Boden vor mir geachtet und war mit einem nassen Platsch in eine riesige Pfütze getreten, die vor uns den Pfad durchbrach wie ein zu klein geratener Fluss. Elara lief ohne ein Zeichen der Abscheu gegenüber der Pfütze weiter und starrte dabei scheinbar gefühllos ins Nichts. Kopfschüttelnd folgte ich ihr, besah mich dann aber eines Besseren und versuchte sie abzulenken. Ich schnitt Grimassen, die eigentlich nicht einmal eine Kichererbse zum Lachen bringen konnten. Aber durch die vielen Regentropfen und die nassen Haare, die an meiner Stirn klebten, erinnerte ich wahrscheinlich an Gollum, der gerade wieder eine Identitätskrise hatte. Ein kurzes, einsames und unsicheres Lächeln huschte über Elaras Gesicht, womit ich mich fürs Erste zufriedengab. Es schien nicht so, als würden wir ihren Bruder finden. So sehr ich mich anstrengte, ich konnte keine lebende Person im Umkreis von … Ich sah kein einziges Lebewesen! Und so langsam konnte man auch schon wieder die vielen blinkenden Polizeiwagen am Ende des Pfades erkennen. Ich hatte echt keine Lust mehr, noch eine Runde um die Bibliothek zu latschen. Also blieb ich abrupt stehen.
Als Elara das bemerkte, traten ihr Tränen in die Augen. „Du willst mich also im Stich lassen?! Dann geh doch! Es ist sowieso nicht sicher, ob Ilias überhaupt noch am Leben ist! Vielleicht kommen unsere Bemühungen schon zu spät!” Ihre dünnen Beine schlugen hart auf den nassen farbigen Kieselsteinen auf.
Ich kniete mich angeekelt neben Elara auf den Boden … Wenn man diese Matschepampe überhaupt noch Boden nennen konnte. Diese sintflutartigen Regenfälle hatten wir, glaubte man meinen Lehrern, dem Klimawandel zu verdanken. „So meinte ich das ja auch gar nicht“, sagte ich. „Ich wollte mit meinem Stehenbleiben nur andeuten, dass … ARRRGHHH!” Ein scharfer Kiesel bohrte sich in meine Kniescheibe. Die Regentropfen brannten in der frischen Wunde. „Ich wollte damit nur andeuten”, wiederholte ich mich mit schmerzverzerrtem Gesicht, „dass ich es für äußerst unlogisch halte, dass wir jetzt schon zum siebten mal hier langlaufen und du immer noch nicht einsehen kannst, dass dein kleiner Bruder hier nicht ist!”
Ich verdrehte die Augen, was langsam schon zu meinem Markenzeichen geworden war, und als meine Pupillen wieder auf Elara gerichtet waren, sah ich, dass sie ihr Gesicht in den dreckigen Händen vergraben hatte, während sie quietschende Laute von sich gab. Mit einem komischen Gefühl im Magen rappelte ich mich auf und ließ mich dann neben ihr wieder fallen.
„Das wird schon wieder … Und wenn nicht, dann musst du wenigstens nicht mehr lange ohne ihn sein, denn wenn deine Eltern das rausbekommen, wirst du wohl von mir gesucht und nicht gefunden werden. Dann werde ich wohl auf dem Boden sitzen und heulen! Was wiederum nichts bringen würde.” Als ich in Elaras gerötetes Gesicht sah, fasste ich mir ein Herz und fuhr fort: „Was ich damit sagen wollte, ist, dass ich auch so besorgt um dich sein würde, wenn du nicht zu finden wärst, aber es nichts bringt zu trauern, obwohl das Schicksal deines Bruders ja noch in den Sternen steht … Und mal so gesehen: Auch wenn es in den Sternen steht, nützt uns das nichts, denn wie du bestimmt schon bemerkt hast, kann man nicht das klitzekleinste Stück Himmel sehen.”
Als ich nach dieser Rede Elaras Blick folgte, erschrak ich selbst. Die schwarzen Gewitterwolken hatten den Himmel regelrecht verschlungen und würden ihn nach meinen bescheidenen Wetterkenntnissen auch nicht so schnell wieder freigeben.
Plötzlich wurde ich von zwei Armen fast erdrückt, was ich kichernd erwiderte. Irgendetwas schien ich mit meiner Rede bei Elara ja durchaus bewirkt zu haben.
„Und jetzt komm“, sagte ich. „Du musst dringend ins Trockene. Und ich werde bei meinem Vater nachbohren, ob es schon etwas Neues gibt.“
Kapitel 13: Elara
Der Regen fiel unermüdlich auf das Dach des Streifenwagens. Es war bereits drei Stunden her, dass Ilias verschwunden war, und es gab immer noch keine Spur von ihm.
Wir werden ihn finden! Versprochen!, hatte John zu Elara gesagt. Aber ganz so zuversichtlich hatte er dabei nicht ausgesehen. Und nun saß sie hier: ohne Bruder, Eltern beide unterwegs und sie mit einer Tasse Tee in der Hand in eine Decke gehüllt auf dem Rücksitz eines Polizeiautos. Ihre Haare waren bis auf die Spitzen mit Regenwasser vollgesogen, und ihre Kleidung haftete an ihrem Körper, wie mit Kleber angeklebt. Mit leerem Blick starrte Elara auf die Stelle, an der sie die Leiche gefunden hatte. Mit Polizeiband hatte die Spurensicherung alles abgesperrt.
Emilia kam langsam auf sie zu. Das Blaulicht der Polizeiautos spiegelte sich auf ihren nassen Wangen. Elara sah sie hoffnungsvoll an, Emilia schüttelte entschuldigend den Kopf. Tränen rollten Elara die Wange hinunter.
Emilia nahm die neben Elara liegende Decke und wickelte sich ebenfalls ein. „Wir werden ihn schon finden! Mach dir keine Sorgen. Du kannst nichts dafür, dass …“
„Natürlich ist es meine Schuld! Mama hat mir die Verantwortung gegeben! ICH habe nicht aufgepasst, ICH habe meinen Bruder verloren und ICH bin daran Schuld!“, unterbrach Elara sie und verbarg das Gesicht in den Händen. Sie weinte und war wütend auf alles und jeden. Vor allem aber auf sich selbst.
„Ich weiß, dass du dir jetzt die Schuld für alles gibst, aber das bringt uns nicht weiter. Hast du noch eine Idee, kennst du einen Lieblingsort, wo er sich aufhalten könnte?“, fragte Emilia sanft.
Elara schüttelte den Kopf. „Er hat keinen speziellen Lieblingsplatz. Er ist allgemein gerne draußen. Aber wir haben ja alles abgesucht. Und wer weiß, ob er überhaupt noch lebt. Hier läuft irgendwo ein Mörder rum, der auf Menschen einsticht! Vielleicht liegt Ilias längst irgendwo tot auf dem Grund der Lippe!“
Beide Mädchen schwiegen.
Polizisten liefen hin und her, die Zeit verstrich, und Elara saß mit Emilia hinten in dem Auto. Irgendwann kam John auf sie zu.
„Wir konnten deinen Bruder bis jetzt noch nicht ausfindig machen. Die Kollegen werden weiter nach ihm suchen, aber euch bringen wir erst mal nach Hause. Elara, vielleicht kommst du mit zu uns, dann können wir dir sofort Bescheid geben, sollte es Neuigkeiten geben?“
Elara nickte zustimmend. Auf keinen Fall wollte sie jetzt allein zu Hause sitzen. „Können wir vorher noch einmal bei mir zu Hause vorbeifahren?“, fragte sie. „Ich würde mir gern trockene Sachen holen. Und vielleicht ist Ilias mittlerweile dort aufgetaucht.“
„Natürlich“, sagte John. Aber in seinem Blick las sie, dass er genauso wenig wie sie daran glaubte, dass ihr Bruder zu Hause auf sie wartete.
Kapitel 14: Elara
Elara stand immer noch unter Schock. Nachdem die drei hier angekommen waren, hatte John schnell drei Pizzen bei einem Lieferservice bestellt, bevor er nach oben verschwunden war.
„Dad ist kurz in seinem Büro, dann kommt er auch gleich zu uns“, hatte Emilia ihr erklärt, während sie gemeinsam den Tisch gedeckt hatten.
Und nun saßen sie hier und aßen schweigend Pizza.
Nach einer Weile fragte Emilia ihren Vater: „Warum machst du so ein langes Gesicht?“
Ihr Vater blickte sie an. Er hatte die Stirn in Falten gelegt, als ob er über etwas nachdachte. „Nun, ich war ja bei dieser Redaktion, und der Mann am Empfang meinte doch tatsächlich, dass der Journalist alle Unterlagen zu seiner Arbeit abgeholt hat. Und zwar nach seinem Todeszeitpunkt! Der Mann am Empfang hatte sich nicht darüber gewundert, denn er wusste ja noch nicht, dass der Journalist ermordet worden war.“
Emilia zog eine Augenbraue hoch. „Vor seinem Todeszeitpunkt? Wie soll das gehen?“
John zuckte mit den Schultern. Elara sog die Luft tief ein, als wollte sie sich selbst beruhigen. Während des restlichen Abendessens sprachen sie kein Wort mehr.
Zusammen gingen die Mädchen anschließend nach oben, um sich die Zähne zu putzen, und dann in Emilias Zimmer, um zu schlafen. Elara jedoch tat kein Auge zu. Allein der Gedanke, ihr Bruder könnte da draußen im Sturm sein, verletzt, vielleicht sogar tot … Sie schüttelte den Kopf, um die Bilder zu vertreiben. Jemand tippte ihr auf die Schulter. Elara schrie auf.
„Chill! Willst du Papa aufwecken?“, fragte Emilia, und kurz darauf leuchtete eine Taschenlampe auf.
„Du hast Nerven!“, murmelte Elara.
„Komm! Wir gehen in Dads Büro! Dort hat er seine Unterlagen zum Fall. Vielleicht finden wir da ja etwas, das uns auf der Suche nach Ilias weiterbringen könnte!“, meinte Emilia.
Elara blickte sie an. „UNS weiterbringen?“
Emilia lächelte. „Na ja … Ich kann das auch alleine machen!“, erwiderte sie herausfordernd.
„Nein.“ Elara stand auf. Sie konnte ja ohnehin nicht schlafen. Und jede Chance, ihren Bruder zu finden, musste genutzt werden. „Wo ist das Büro?“
„Hinten am anderen Ende des Ganges. Aber Vorsicht! Die Tür daneben ist das Schlafzimmer von Dad! Und die Holzdielen knarren seeeehr laut, ich rede aus Erfahrung.“
Emilia ging mit ihrem Handy vor, während Elara mit der Taschenlampe hinter ihr herschlich. Ganz langsam drückte Emilia die Türklinke herunter und trat in das Büro. Elara folgte ihr. Als beide drinnen waren, schlossen sie die Tür. Emilia knipste das Licht an, und Elara sah den Raum: Ein großer Schreibtisch mit einem Stuhl stand vor dem Fenster gegenüber der Tür, rechts daneben eine Kommode mit Fotos und einer Magnettafel und links ein deckenhohes Regal voller Aktenordner.
„Ja, ich weiß, voll toll!“, sagte Emilia. „Du durchsuchst die Aktentasche und ich seinen Schreibtisch, da verstaut er meistens Infos über seine neuen Fälle.“
Sie deutete auf die auf dem Schreibtisch liegende Aktentasche, während sie anfing die unterste Schreibtischschublade zu durchsuchen. Elara löste die beiden Schnallen der ledernen Aktentasche und öffnete sie. Darin befanden sich eine Geldbörse, eine Stiftschatulle aus Metall, ein Dienstausweis und ein kleines digitales Notizbuch. Es sah aus wie ein E-Book-Reader, nur dass man statt Bücher darüber zu lesen Notizen hineinschreiben konnte. In einem Namenskästchen auf dem Cover stand der Name des Besitzers: Kenny McAngus.
„Schau mal hier!“, forderte sie Emilia auf. „Das muss das Notizbuch sein, das die Spurensicherung an der Lippe gefunden hat. Worüber er wohl so geschrieben hat?“ Emilia antwortete nicht, sondern klappte den Laptop auf, der auf dem Schreibtisch stand, und gab den Namen des Journalisten in die Suchleiste ein. Sie stießen auf mehrere Einträge. „Er war Journalist beim Kleeblatt. So viel wussten wir ja schon. Er hat wohl über mehrere Firmen, die dazu beitragen, die Natur zu zerstören, kritisch berichtet, und soll sich generell für Umweltthemen interessiert haben“, fasste Emilia zusammen.
„Aber was hat das mit seinem Tod zu tun?“, fragte Elara. „Und wie soll uns das alles überhaupt mit Ilias weiterhelfen?“
Emilia runzelte die Stirn. „Na ja: Wenn wir herausfinden, wer diesen Kenny ermordet hat, finden wir vielleicht auch Ilias! Vielleicht hat er den Mörder überrascht?“
Elara schluckte. „Aber dann … ist er vielleicht schon tot!“
„Vielleicht hat er sich auch einfach versteckt!“, gab Emilia zurück.
„Vielleicht ist er entführt worden!“, sagte Elara.
„Vielleicht sitzt er gerade an einer Bushaltestelle“, meinte Emilia.
Elara strafte sie mit einem bösen Blick.
Emilia hob beschwichtigend die Hände. Dann sagte sie: „Aber es gibt keine Hinweise darauf, dass ihm etwas Schlimmes zugestoßen ist! Wir werden ihn finden! Ganz bestimmt. Guck jetzt endlich in das Buch!“
Elara schlug das dünne Heft auf und schaltete es ein. Auf der ersten Seite war nochmals das Cover abgebildet. Als sie auf den Knopf drückten, der die nächste Seite aufschlagen sollte, erschienen Buchstaben.
„LIVE Kraftwerk: Alles Betrug? Das klingt wie ein Zeitungsartikel. Guck mal online, wann der erschienen ist!“, bat Elara.
Emilia suchte auf der Website vom Kleeblatt, fand jedoch nichts. „Vielleicht ist er noch gar nicht erschienen?“, überlegte sie. „Lies weiter!“
„Hohe Einnahmen, verbotenes Abbauen von Kohle, die in einem illegalen Kraftwerk verstromt wird, Betreiberin streitet weiterhin alles ab … Das klingt gar nicht gut. Aber weiterbringen tut es uns auch nicht!“, meinte Elara und seufzte.
„Vielleicht ja doch“, sagte Emilia nachdenklich. „Wenn ich die Betreiberin des Kraftwerks wäre, hätte ich sicher nicht gewollt, dass jemand diesen Artikel liest.“
„Du meinst …“, setzte Elara an, wagte es aber nicht, den Satz zu Ende zu sprechen.
Emilia nickte. „Lass uns hinfahren. Vielleicht finden wir da ja was. Beziehungsweise: Vielleicht finden wir dort Elias. Falls du Recht damit hast, dass der Mörder ihn entführt hat …“
Elara nickte zustimmend. Und so packten sie Emilias Rucksack mit ihrem Handy, auf dem die abfotografierten Seiten des Notizbuches waren, zwei Flaschen Wasser und zwei Äpfeln. Bevor sie aufbrachen, flitzte Elara noch einmal schnell auf die Toilette. Als sie zurückkam, saß Emilia am Schreibtisch und schrieb.
„Was sitzt du noch hier herum?“, fragte Elara aufgeregt. „Los geht’s.“
Eilig zogen sie Jacken und Schuhe an und liefen los zur nächsten Bushaltestelle.
Kapitel 15: Elara
Ich hatte das Kraftwerk schon öfter gesehen, wenn Ilias und ich mit unseren Eltern daran vorbeigefahren waren. Von der Autobahn aus sah es nicht so groß aus. Doch nun standen wir davor und es war wortwörtlich riesig. Durch die hohen Windmühlen der Windkraftanlage, die sich drehten, wirkte das Ganze noch riesiger.
„Sollen wir es wagen, da reinzugehen? Nicht, dass wir nachher so wie der Journalist enden”, sagte ich.
„Keine Sorge”, sagte Emilia, „ich habe große Erfahrung damit herumzuschnüffeln. Denn mein Vater ist ja Polizist, und ich habe mich immer schon für Detektivsachen interessiert. Und je mehr ich mich um das Thema gekümmert habe, umso besser wurde ich.”
„Hast du denn keine Angst?”, fragte ich.
„Doch klar. Aber ich sage mir immer, die goldene Hauptregel beim Detektivsein ist: Versuche so leise wie möglich zu sein. Und dann klappt es.”
Ich nickte. Durch sie konnte ich mich etwas beruhigen. Also gingen wir näher an das Gelände heran.
„Siehst du einen Eingang?”, fragte ich.
„Da!” Emilia zeigte auf ein Rohr, das aus dem Boden ragte. „Da passen wir locker rein.“
„Und woher wissen wir, dass es wirklich zu diesem unterirdischen Kraftwerk führt?“, fragte ich skeptisch.
„Nun ja“, sagte Emilia. „Ganz sicher können wir da erst sein, wenn wir hindurchgeklettert sind. Ich kann auch als erstes hineingehen.”
„Na gut“, sagte ich. „Aber wie kommen wir dahin? Der Zaun hier versperrt uns den Weg.“
„Wie wär’s, wenn wir durch dieses Loch da gehen“, meinte Emilia. „Das hat wohl der Journalist in den Zaun geschnitten.”
Nachdem wir durch das Loch gegangen waren, kamen wir endlich am Rohr an.
Wir kletterten hindurch und erreichten eine große Halle, in der noch mehr Rohre waren. Vor allem auch noch Mitarbeiter.
„Was machen wir denn jetzt?”, flüsterte ich. Wir mussten nur ein Geräusch machen und schon würden sie merken, dass wir hier waren.
„Kannst du springen?”, fragte Emilia.
„Wieso?”
„Weil das unsere einzige Möglichkeit ist, hier durchzukommen. Wir müssen über die Spalte und auf die Leiter dort springen.“
„Spinnst du?”, fragte ich ernst.
„Nein. Ich gehe auch zuerst.”
Ich war besorgt, doch bestimmt wusste Emilia, was sie tat. Sie stand konzentriert da. Wahrscheinlich versuchte sie abzuschätzen, wie weit und hoch sie springen musste. Danach zählte Emilia leise bis drei und sprang. Ich rannte schnell zu dem Punkt, von dem aus sie gesprungen war. Ich konnte sie nicht mehr sehen. War sie in das Rohr gefallen, das direkt unter der Spalte zu sehen war?
„Emilia?”, flüsterte ich, „alles okay?”
„Ich bin hier”, sagte sie.
Sie war eine Ebene unter mir auf einer der oberen Sprossen gelandet. Komisch, dass ich sie nicht gleich gesehen hatte.
„Kommst du auch?”, wollte sie wissen.
Ich ging einen Schritt zurück und nahm all meinen Mut zusammen. Auch ich zählte bis drei und sprang! In dem Moment hoffte ich nur eins: Bitte lass mich auf der Leiter landen! Und ich hatte Glück. Ich war zwar etwas tiefer als Emilia gelandet, aber immerhin auf der Leiter.
Wir kletterten die Leiter hoch und mussten noch mal durch ein Rohr gehen. Ich sage nur eins: Derjenige, der hier so viele Rohre hingebaut hatte, den sollte man verklagen. Es war nämlich wirklich anstrengend, die ganze Zeit nur zu klettern und zu krabbeln. Am Ende kamen wir an einer dunklen Kreuzung an, von der aus viele Wege in unterschiedliche Richtungen führten. Emilia und ich entschieden uns für einen, der nach rechts abging. Diskutieren brauchte man ja deswegen nicht. Je weiter wir den Weg entlanggegangen waren, umso lauter hörten wir Frauenstimmen. Schließlich waren wir so weit, dass wir hören konnten, was genau sie sagten.
„Was wollen wir jetzt machen?”, fragte die eine Stimme, „irgendwann wird ans Licht kommen, was ich getan habe.”
„Wenn wir es verheimlichen, wird schon nichts passieren“, sagte die andere Stimme. „Außerdem war es gut. Stell dir vor, es würde an die Öffentlichkeit geraten, was wir hier machen.”
Immer weiter folgten wir den Stimmen. Sie waren schon sehr laut geworden. Doch plötzlich packte mich jemand an der Schulter.
„Was wollt ihr hier?”, fragte ein Mann.
„Wir … wir sind die Kinder von einem Mitarbeiter hier und wollten uns mal die Arbeitsstelle unseres Vaters ansehen“, sagte Emilia schnell. „Wir wollen später nämlich auch hier arbeiten, und da wollten wir wissen, was man in diesem Beruf genau machen muss.”
Der Mann schaute uns streng an. Wahrscheinlich glaubte er uns nicht.
Ein anderer Mann kam in unsere Richtung. Er trug einen Helm und dunkle Kleidung. Sein Gesicht war voller Kohlenstaub. „Norman, was ist?”, rief er.
„Ich wollte von den Kindern wissen, was sie hier zu suchen haben.”
„Kinder!?”, sagte der andere erstaunt. Schnell rannte er zu uns. „Ich heiße Colin und bin der Obersteiger hier. Wenn ihr hier reingeht, muss ich das von euren Eltern höchstpersönlich wissen. Damit ihr also keinen Ärger kriegt, würde ich euch raten, dass ihr wieder nach Hause geht.”
Wahrscheinlich wäre es wirklich das Schlauste, wenn wir jetzt einfach gingen, dachte ich. Doch dann stellte ich mir vor, dass Ilias irgendwo hier ganz allein eingesperrt war. Ich wollte ihn keine Sekunde länger warten lassen. „Aber wir beide finden den Beruf so spannend!”, log ich deshalb, „wollen Sie uns wirklich unseren Traum zerstören?”
„Hör mal, kleines Mädchen”, begann Colin, während Norman nur neben ihm stand und zuguckte.
„Ich bin 13 Jahre alt und nicht mehr klein. Nur dass Sie das wissen”, gab ich zurück.
„Wie auch immer”, sprach Colin weiter, „ihr geht jetzt besser schnell nach Hause und stört nicht die Arbeiter hier.“
„Sie meinen wohl die Arbeiter, die hier Kohle abbauen, nur um ein geheimes unterirdisches Kohlekraftwerk am Laufen zu halten, ohne dass sie das eigentlich dürften. Ja, reden Sie weiter …”, sagte Emilia.
Colin guckte erstaunt.
Kapitel 16: Colin und Norman
„Ich sag doch”, jammerte Norman, „Kinder sind immer schlau.“
Colin wurde wütend: „Denkst du, ich bin jemand, den das gerade so was von interessieren würde?” Damit brachte er Norman zum Schweigen. Er drehte sich wieder zu den Kindern um, doch die waren heimlich geflohen. „Aktivier den Alarm, wir haben hier ganz ärgerliche Kinder.”
Gesagt, getan. Norman drückte auf einen roten Knopf in der Wand und löste dadurch ein lautes Geräusch aus. Dann machte er eine Durchsage: „Liebe Mitarbeiter, wenn Sie hier zwei Mädchen sehen, das eine hat blonde wellige Haare und das andere dunkle Locken, bringen Sie sie in Colin Maskners Büro. Danke!“
Kapitel 17: Elara
Als wir die Durchsage hörten, rannten wir um unser Leben.
„Nichts wie weg!“, rief Emilia.
Doch es war schon zu spät. Im Gang vor uns hatten sich an die 30 Mitarbeiter in den Weg gestellt. Und auch in die andere Richtung brauchten wir nicht zu rennen, denn dort hatten sich ebenfalls mindestens 40 Mitarbeiter versammelt.
„Was machen wir nur?“, sagte ich besorgt.
„Einfach ruhig stehenbleiben“, murmelte Emilia.
Und so bewegten wir keinen Muskel mehr.
„Bringt sie in mein Büro!“, befahl Colin, der nun zwischen den Arbeitern auftauchte.
Im Büro fragte Colin dann: „Was wolltet ihr wirklich hier machen? Ich glaube euch keinesfalls, dass ihr nur rumstöbern wolltet, um euch die Arbeitsstelle eures Vaters anzuschauen. Netter Versuch, doch bei mir hat diese Lüge nicht gereicht, um euch einfach gehen zu lassen. Also raus mit der Wahrheit.“
Emilia und ich guckten uns verzweifelt an. Doch wir entschieden uns für alles andere als die Wahrheit. Das war klar.
„Lassen Sie uns gehen, und wir stören Sie nicht noch einmal“, sagte Emilia.
Ich nickte. „Dann gibt es auch keine weiteren Probleme.“
„Gut, ihr wollt nicht mit der Wahrheit rausrücken. Dann ziehen wir eben andere Seiten auf. Jemand wird sich gleich um euch kümmern. Jemand, der ganz sicher die Wahrheit aus euch herausbekommt.“
Einer der Mitarbeiter fesselte uns an der Wand fest. Dann verließen sie den Raum.
„Lassen Sie uns hier raus!”, riefen Emilia und ich gleichzeitig. Doch diesmal gab es leider keine Möglichkeit zu fliehen. Wir dachten nach. Das Einzige, auf das wir hoffen konnten, war, dass jemand uns retten und hier rausbringen würde. Und was war mit Ilias? Plötzlich fing ich an zu weinen.
Emilia sah mich mitfühlend an. „Hey, ist doch alles okay. Okay, es ist nicht okay. Aber die werden uns schon nichts tun. Mein Vater wird uns retten. Mach dir da keine Gedanken.”
Kapitel 18: Ilias
Geduldig wartete Ilias, bis die Bücherei öffnete. Kaum wurden die Türen aufgeschlossen, lief er zur Bibliothekarin.
„Hallo“, sagte er, „ich war gerade zu Hause, und es hat keiner aufgemacht. Ich weiß einfach nicht, was ich machen soll. Darf ich eine Weile hier bleiben, bis meine Schwester zurück ist?“
Die Bibliothekarin dachte: Der Junge ist bestimmt der vermisste.
„Natürlich“, sagte sie zu Ilias. „Möchtest du vielleicht etwas trinken?“
Dankbar nickte Ilias.
Die Bibliothekarin schnappte sich das Telefon und rief auf dem Weg in die Teeküche die Polizei an. Schnell erzählte sie von dem Jungen. Dann kehrte sie zurück, gab ihm ein Glas Apfelschorle und setzte sich zu ihm.
Wenig später kam ein Polizist in die Bücherei. Er sagte: „Hallo, ich bin John und würde gerne mit dir reden. Bist du Ilias?“
Ilias nickte.
„Wir haben dich gesucht“, sagte der Polizist. „Wo warst du denn die ganze Zeit?“
Ilias sagte: „Ich bin mit drei Fröschen unterwegs gewesen. Sie haben mir einen schönen Ort an der Lippe gezeigt.“
Der Polizist fragte: „Haben die Frösche denn auch Namen?“
„Ja, sie heißen Kinoko, Fukasaku und Balsamico“, sagte Ilias.
„Das sind ja verrückte Namen“, meinte John. „Hast du sie so genannt?“
Ilias sagte: „Nein, sie haben mir ihre Namen verraten.“
Der Polizist grinste. Dann fragte er: „Wo warst du denn in der Nacht?“
„Im Wald bei einem Jungen“, erzählte Ilias. „Er heißt Lukas. Ich durfte dort übernachten. Er wohnt in einem richtig tollen Baumhaus, wo er alles hat, was er zum Leben braucht.“
Der Polizist schmunzelte.
Ilias dachte: Das ist ja wieder typisch Erwachsene, glauben einem nie.
„Warum bist du denn überhaupt in den Wald gelaufen?“, wollte John nun wissen.
Ilias sagte: „Ich … ich habe … gesehen, wie jemand an der Lippe angegriffen wurde, und Angst bekommen und mich im Wald versteckt. Und da habe ich dann den Jungen getroffen.“
John runzelte besorgt die Stirn. „Wie sah denn der Mensch aus, der angegriffen wurde?“
Ilias sagte: „Er hatte einen Hut auf und einen Mantel an. Mehr konnte ich nicht sehen.“
„Und was ist dann passiert?“
„Sie ist einfach weggegangen“, sagte Ilias.
„Sie?“, fragte John überrascht. „War es eine Frau, die den Mann angegriffen hat?“
Ilias nickte.
„Und wie sah die Frau aus?“, fragte John.
Ilias sagte: „Gesehen habe ich nur, dass sie rote Haare hatte.“
„Würdest du sie denn wiedererkennen?“, fragte John.
Ilias sagte: „Ich glaube schon.“ Er fing an zu weinen. „Ich habe richtig viel Angst und möchte zu meiner Schwester.“
John sagte: „Okay, ich fahre dich dann jetzt zu ihr.“
Ilias schluchzte: „Ich war schon zu Hause. Da ist niemand.“
„Ich weiß, wo deine Schwester ist“, sagte John. „Sie ist bei meiner Tochter, da sie bei uns übernachtet hat. Sie hat sich richtig um dich gesorgt.“
Ilias hörte gar nicht mehr richtig zu. Seine Gedanken kreisten schon darum, wie es wohl so war, in einem Polizeiauto zu fahren. Durfte er wohl auch mit Sirene und Blaulicht fahren, fragte er sich.
Als sie draußen waren, winkte Ilias Balsamico zu, den er zwischen den Büschen am Wegesrand entdeckte.
John fragte: „Wem hast du gewinkt?“
„Ach niemandem“, sagt Ilias.
Dann stiegen sie ins Auto und fuhren los. Unterwegs dachte Ilias noch einmal an die Begegnung mit Lukas zurück.
Kapitel 19: Ilias – Rückblende
Ich hatte panische Angst, als ich durch den Wald rannte. Durch die Wand aus Regen konnte ich kaum etwas erkennen. Was hatte ich gerade gesehen? Eine Frau, die mit einem Messer von jemandem wegrannte, der Angst vor ihr gehabt hatte und nun im Matsch lag. Ich verdrängte die Gedanken und lief weiter. Plötzlich stieß ich mit einem Jungen zusammen, der ungefähr in dem Alter meiner großen Schwester war.
„Was machst du hier? Es ist gefährlich, so spät allein im Wald zu sein“, sagte er.
„D-da war eine Frau … Sie hatte ein Messer …“ Ich war noch ganz durcheinander.
„Beruhig dich doch erst mal und komm mit in mein Baumhaus. Da kannst du mir alles in Ruhe erzählen“, sagte der Junge.
Ich war so geschockt von dem, was ich beobachtet hatte, dass ich gar nicht darüber nachdachte, wer der Junge war oder was er hier machte, sondern ihm einfach folgte.
Unterwegs fragte ich dann doch: „Wie heißt du eigentlich?“
„Lukas“, sagte er. „Und du?“
„Ilias“, antwortete ich. Plötzlich donnerte es ohrenbetäubend. „A-ahh … D-d-d-Donner …“, flüstere ich. „Ich habe Angst …“
„Das brauchst du nicht“, meinte Lukas und stieß ein Heulen wie von einem Wolf aus.
Auf einmal raschelte es leise im Gebüsch und drei schwarze Wölfe sprangen hervor.
„Keine Angst, die sind zahm“, sagte Lukas, bevor ich überhaupt reagieren konnte.
Ich zitterte vor Nässe und Kälte am ganzen Körper. Wir kamen am Baumhaus an und kletterten die Strickleiter hoch. Ich spähte nach unten und sah, dass die Wölfe um den Baum patrouillierten. Oben angekommen blickte ich mich neugierig um. Es gab einen Fernseher, eine Maschine, die, vermutete ich, Kakao machen konnte, und einen elektrischen Kamin. Auf dem Bett saß ein Mädchen mit karamellfarbenen Locken und einem komischen Anzug aus schwarzem Stoff.
„Hallo, ich bin Beyla, und wer bist du?“, fragte sie mich mit einem freundlichen Lächeln.
„Ich bin Ilias“, antwortete ich.
„Komm mit, wir holen dir erst mal was Trockenes zum Anziehen“, sagte Lukas und führte mich zu einem geheimen Durchgang im Baum. „Deorum de Phoenix, aperi illud“, sprach er ernst.
Ich war nicht gerade der Profi, aber ich wusste durch meine nervige große Schwester, dass das Latein war. Es rumpelte und krachte, und … da war plötzlich eine Treppe im Inneren des Baumes. An den Wänden hingen erstaunlicherweise rote und schwarze Fackeln. Unten an der Treppe schloss sich eine riesige Höhle an, in der alle möglichen Fahrzeuge und Geräte standen. An der Decke flog ein brennender Vogel entlang.
„Boah, Wahnsinn!!!“, rief ich, als wir weitergingen.
Etwas sprang auf meine Schulter und schmiegte sich an mich.
„W-was …?“, fragte ich, während das Etwas metallisch „Pika-Pika!“ sagte.
Lukas meinte: „Hast du einen neuen Freund gefunden, Pika?“
„Moment mal … Pikachu?? Wie das Pokémon?“, fragte ich.
„Ja, ich habe viel Freizeit und baue Metallkopien von allen möglichen Sachen.“ Lukas reichte mir ein Stoffanzug, wie Beyla ihn trug, und sagte: „Im Nebenraum dort bist du ungestört und kannst dich umziehen.“ Er zeigte auf eine Tür in halber Höhe der Treppe.
Als ich die Treppe nach oben ging, sagte Lukas: „Tut mir leid, aber Pikachu darf nicht mit nach oben, ist so Vorschrift.“
Pikachu klang traurig, als es die Treppe hinunterhüpfte, und Lukas meinte: „Aber wir können heute mal eine Ausnahme machen …“
Als ich umgezogen war, der Anzug war nebenbei bemerkt echt bequem, gab Lukas mir noch einen Beutel für meine nassen Sachen, und dann gingen wir wieder hoch aufs Baumhaus, wo Beyla schon mit Kakao auf uns wartete.
Am nächsten Morgen erwachte ich sehr früh von den Geräuschen des Fernsehers. Die Fernsehnachrichten waren eingeschaltet. Der Sprecher sagte gerade: „… Es wurde eine Vermisstenanzeige für den 6-jährigen Ilias aufgegeben. Sein letzter bekannter Aufenthaltsort ist die Bücherei. Falls ihn jemand findet, bringen Sie ihn …“
„Na, jetzt musst du uns aber schnell alles erzählen“, meinte Beyla.
Also erzählte ich ihnen, was geschehen war, und Beyla sagte: „Du musst zu deiner Schwester zurückgehen.“
„Warum sollte ich“, antwortete ich. „Gestern in der Bücherei war es ihr ganz egal, was mit mir ist. Ich glaube nicht, dass sie mich vermisst.“
„Vielleicht denkst du das nur. Sie wollte bestimmt bloß ihre Ruhe und war genervt, weil eure Eltern gesagt haben, dass sie auf dich aufpassen muss.“
„Hm … Kann sein …“, entgegnete ich.
„Ich denke, du solltest zurückgehen“, sagte Beyla.
„Du darfst uns aber jederzeit besuchen kommen“, schaltete sich Lukas ein.
„Okay …“, meinte ich widerstrebend. Dann machte ich mich auf den Weg zurück in die Bücherei.
Kapitel 20: John
Ich halte Ilias die Autotür auf und steige dann selber auf der Fahrerseite ein. Der Regen trommelt laut gegen das Dach, und ich schalte direkt den Scheibenwischer an, der hektisch hin und her wedelt. Ich versuche, Ilias auf der Fahrt mit einer Kinderlieder-CD aufzumuntern, aber der kleine Mann starrt nur aus dem Fenster und schaut sich die vorüberrasenden Bäume und Büsche an. Ab und zu blicke ich zu ihm rüber, aber ich muss mich auf die Straße konzentrieren. Ich bin froh, dass er gleich wieder bei seiner Schwester sein wird, und fahre noch etwas schneller. Als wir zu Hause angekommen sind, parke ich mein Auto in der Einfahrt. Ilias steigt direkt aus und wartet ungeduldig an der Tür auf mich. Ich schließe ihm auf, und zusammen betreten wir das Haus.
„Deine Schwester und meine Tochter schlafen sicher noch“, sage ich zu Ilias. „Willst du sie wecken? Das Zimmer ist in der ersten Etage.“
Schon flitzt Ilias los.
Während er nach den beiden Mädchen sucht, mache ich uns beiden Kakao. Nach einer Weile kommt Ilias allerdings ohne Emilia und Elara zurück … Besorgt gucke ich ihn an, doch er schüttelt nur den Kopf und zuckt mit den Achseln. Ich gehe zusammen mit ihm ein zweites Mal in Emilias Zimmer. Es ist leer. Ich schaue aus dem Fenster in den Garten. Vielleicht sind sie draußen? Nichts. Ich gucke mich noch mal im Zimmer um, vielleicht haben die beiden ja einen Zettel oder so hinterlassen. Ich finde zwar keinen Zettel, dafür aber ein aufgeschlagenes Buch. Liebes Tagebuch. Elara und ich fahren jetzt zu dem Kraftwerk Live, um herauszufinden, ob sie etwas mit Kennys Tod und Ilias’ Verschwinden zu tun haben. Wir sind jetzt Detektive 😉 Der Rest ist kaum leserlich. Das Einzige, was ich noch lesen kann, ist das Wort Notiz. Ich eile in mein Büro und schalte das elektronische Notizbuch ein, dass die Spurensicherung am Tatort gefunden hat. Gestern Abend bin ich nicht mehr dazu gekommen, darin zu lesen. Nun überfliege ich eilig den Artikel, den Kenny McAngus dort abgespeichert hat. Das ist ja unglaublich, denke ich, als ich von einem unterirdischen Kohlekraftwerk und einem unterirdischen Steinkohlenbergwerk lese, die angeblich unterhalb des Ökostrom-Kraftwerks betrieben werden. Schnell eile ich weiter in den Flur und fange an, meinen Mantel und meine Stiefel anzuziehen, als mir plötzlich Ilias wieder einfällt. Der steht da und schaut mich mit großen Augen an.
„Du kannst mitkommen“, sage ich, und er zieht auch ganz schnell seine Jacke an. „Elara und Emilia haben einen kleinen Ausflug gemacht“, behaupte ich. Dass die beiden Mädchen in Gefahr sind, will ich ihm erst mal nicht sagen.
Kapitel 21: John
„So, da wären wir. Das sollte das Kraftwerk sein, zu dem Elara und Emilia wollten“, sage ich, während ich aus dem Auto steige.
Ilias plumpst aus dem Auto und reißt dabei Emilias alten Kindersitz mit, den ich für die kurze Fahrt noch aus der Garage gekramt habe. Nach einem kurzen Hinweis, dass Ilias bitte noch die Autotür hinter sich zumachen soll, schließe ich das Auto ab.
Ich stehe mit Ilias in einem kleinen Waldstück kurz vor einem abgelegenen Ökostromgebiet, dem Kraftwerk LIVE. Solche Gebiete sind immer voll mit Windrädern und Solaranlagen und deshalb riesig groß. Wie soll ich meine Tochter und Elara auf einem solchen Gelände nur finden? Ich hoffe, das Sondereinsatzkommando rückt gleich hier an. Ich kann nicht auf eigene Faust einfach in ein Ökostromgebiet einbrechen, schon gar nicht bei diesem fiesen Nieselregen und mit einem Erstklässler im Schlepptau, der erst gestern Zeuge eines Mordes werden musste. Außerdem ist es noch ein kleiner Fußmarsch bis zum Zaun. Ich konnte ja nicht einfach davor parken, die Betreiber werden bestimmt Sicherheitskameras installiert haben. Oh nein, hoffentlich geht es den Mädchen gut. Ich hätte mich mehr um meine Tochter kümmern müssen, nicht immer nur um die Arbeit. Vielleicht hätte sie mir dann von ihren Plänen erzählt, und ich hätte sie aufhalten können. Ich muss sie finden, ich muss einfach.
Der kleine Ilias unterbricht mich in meinen Überlegungen: „Ich will zu Elara, und mir ist kalt!“
Ich versuche, ihm die Situation zu erklären: „Wir haben im Moment das Problem, dass wir gar nicht genau wissen, wo deine Schwester ist. Allerdings haben wir einen Hinweis, dass sie sich mit Emilia dort hinten im Ökostromgebiet aufhalten könnte. Deshalb versuchen wir, sie zu finden. Gleich kommen ein paar Kolleginnen und Kollegen von meiner Arbeit und helfen uns dabei. Wichtig ist, dass du genau das tust, was wir dir sagen, und schön ruhig bist, damit wir deine Schwester finden können, ja?“
„Sind das deine Leute da hinten?“, wirft Ilias ein.
Ich entgegne: „Ja, das dürften sie sein, gut erkannt.“ Eine Reihe Streifenwagen fährt über den matschigen Waldweg, der voller Pfützen steht, herbei und parkt neben uns. Wenig später kommt meine Kollegin Sandra zu mir. Sie leitet das SEK in unserer Abteilung. Rasch besprechen wir das nähere Vorgehen, während Ilias von einer anderen Kollegin in Obhut genommen und darüber aufgeklärt wird, was als nächstes passiert und wie er sich verhalten soll. Er wird erst mal mit der Beamtin im Polizeiwagen bleiben, bis die Situation deeskaliert ist.
Zunächst laufen Sandra und ich alleine zum Eingangstor des Kraftwerks und bitten darum, hereingelassen zu werden, was auch im nächsten Moment geschieht. Das Schiebetor öffnet sich, und uns kommen zwei Arbeiter, von denen einer voll mit schwarzem Staub ist, entgegen.
„Guten Tag, die Herren. Wir sind vom Dorstener Kommissariat und haben Anhaltspunkte dafür, dass Sie hier illegal ein unterirdisches Kohlekraftwerk betreiben, und würden uns die Anlage daher gerne anschauen“, beginnt Sandra das Gespräch mit den Arbeitern, ohne dabei zu erwähnen, dass wir eigentlich wegen eines Mordfalls und zweier vermisster Kinder hier sind, woraufhin einer der Männer verdattert entgegnet: „Polizei, waaas?“
Der andere Arbeiter tritt, ohne den Blick von uns abzuwenden, auf den Fuß seines Kollegen und beginnt sich für diesen zu rechtfertigen: „Sie müssen meinen Arbeitskollegen Norman hier entschuldigen. Er ist solche Situationen nicht gewöhnt, er arbeitet heute den ersten Tag als Aufseher in der Firma. Ich bin Colin Maskner, Vorarbeiter und Aufseher hier im LIVE-Ökostrombetrieb. In Bezug auf ein unterirdisches Kohlekraft muss ich Sie enttäuschen.“ Er lacht. „Da wollte Ihnen wohl jemand einen Bären aufbinden. Ich kann Sie gerne etwas herumführen. “
„Wir bitten darum. Und wie war noch gleich Ihr Name?“, richte ich mich an den Arbeiter, der scheinbar Norman heißt.
Dieser antwortet: „Friedwell. Norman Friedwell.“
Dann führen uns Herr Maskner und Herr Friedwell einmal am Zaun vorbei um das Gelände, allerdings nicht in das Herz des Ökostromgebiets. Das ist sehr seltsam, da muss etwas dahinterstecken, Herr Maskner möchte ganz sicher etwas vor uns verbergen.
„Und was ist da am Kontrollturm?“, frage ich. „Ich will mir den mal genauer anschauen!“
„Nee, der ist im Moment außer Betrieb“, entgegnet Herr Maskner.
Norman fügt hinzu: „Colin hat Recht, da können wir nicht hingehen, Anweisung von der Chefin.“
Sandra wird stutzig: „Soso. Dann wollen wir den Turm erst recht einmal-“
„Das können wir leider nicht machen, tut mir leid“, fällt Herr Maskner Sandra ins Wort. Er blockiert uns den Weg. „Das ist Privatgelände! Ich kann Sie hier nicht durchlassen!“
Mir wird klar, dass die Situation jetzt kippt, und ich rufe Verstärkung, als eine Gruppe Bodyguards sich zügigen Schrittes annähert. Normalerweise müssten wir jetzt gehen, allerdings ist das hier eine Ausnahme.
Ich mache Herrn Maskner und Herrn Friedwell klar: „Entweder Sie zeigen uns jetzt das gesamte Gelände und den Turm, oder wir müssen gewaltsam eingreifen. Wir ermitteln in einem Mordfall und haben den Verdacht, dass Sie hier zwei Kinder festhalten!“
Herr Maskner entgegnet entschlossen: „Dann versuchen Sie es doch, alleine kommen Sie nie gegen unsere Männer an. Außerdem dürfen Sie das doch eh nicht, braucht man dazu nicht einen Durchsuchungsbeschluss oder so?“
An diesem Punkt ist Sandra und mir klar, dass das hier nicht friedlich zu lösen sein kann. Wir wechseln noch kurz einen Blick, dann gibt Sandra dem bereits angekommenen und versteckten Sondereinsatzkommando ein schnelles Zeichen, woraufhin dieses mit taktischen Schutzschilden aus seinem Versteck kommt. Die Polizeibeamtinnen und –beamten eilen vor uns her und versuchen mit aller Kraft sich durchzukämpfen, damit Sandra und ich an den Männern vorbei zum verdächtigen Kontrollturm gelangen können. Die Bodyguards von LIVE brüllen und versuchen wild um sich schlagend gegen unsere Leute anzukommen, doch keine Chance. Sie kommen an den Schutzschilden nicht vorbei. Dann setzt ein Beamter Tränengas ein. Die Bodyguards winden sich und weichen zurück, die beiden Arbeiter hauen ab. Endlich kommen Sandra und ich an den Männern vorbei und rennen in Richtung des Kontrollturms. Wir werden von fünf Kolleginnen und Kollegen begleitet, während die restlichen die Bodyguards von LIVE mit Handschellen fesseln. So schnell wir können, rennen wir zum Kontrollturm. Dort angekommen staunen wir. Vor uns führt eine riesige, scheinbar viel befahrene Einfahrt in eine Art unterirdisches Bergwerk. Aus dem Boden ragen Türme eines Kraftwerks, die von hohen Steinmauern vor Blicken abgeschirmt werden. Kenny McAngus hatte tatsächlich Recht. Das muss das unterirdische Kohlekraftwerk samt Steinkohlebergwerk sein, das er gemeint hat.
„Komm schon, John, wir müssen die Kinder finden!“, ruft Sandra mir zu, die bereits auf dem Weg die Einfahrt runter ist. Ich laufe ihr schnell hinterher. Als wir unten angekommen sind, schleichen wir uns an der kalten Betonwand entlang, um nicht gesehen zu werden. Ich blicke mich um, alles ist voller Rohre, viele Tunnel führen von hier, was der Hauptraum zu sein scheint, weiter unter die Erde.
„Das ist ja riesig hier“, flüstere ich Sandra zu, die daraufhin zustimmend nickt.
Unsere Blicke schweifen weiter umher, dann entdeckt Sandra etwas: „Siehst du das, da oben? Da scheint ein Büro zu sein. Und da, hinter der Scheibe, sind das deine Tochter und ihre Freundin?“
Sandra hat tatsächlich Recht. Ach, Emilia, was machst du nur? Du kannst doch nicht auf eigene Faust ein Unternehmen aufhalten, das vielleicht schon seit Jahren seine kriminellen Machenschaften vor der Polizei verheimlichen konnte. Sandra und ich bewegen uns vorsichtig durch den Gang, in dem wir den Raum vermuten, in dem Emilia und Elara an die Wand gefesselt festgehalten werden, da hören wir zwei aufgeregte Frauenstimmen. Wir scheinen entdeckt worden sein, leider kann ich nichts Genaueres verstehen, die Wände hier sind dick. Die Stimmen scheinen aus einem der Räume zu kommen. Mir läuft ein Schauer über den Rücken, ich habe fürchterliche Angst. Ich will nur Emilia und Elara retten und uns alle hier aus dem Laden rausbringen. Während ich solche Panik schiebe, sehe ich im Augenwinkel, wie Sandra sofort reagiert und unsere Kolleginnen und Kollegen, die uns hierher begleitet haben, anweist. Daraufhin stürmen diese nacheinander durch die Tür des Raumes, aus dem die Frauenstimmen gekommen sind.
Kapitel 22: Viktoria
Kurz vorher …
Ich stehe neben Jane in ihrem Büro und berichte ihr vom Ausgang meines letzten Auftrags, als Norman, einer unserer Angestellten, den Jane letztens noch befördert hat, damit er endlich nicht mehr um mehr Geld jammert, wegen seiner ach so beknackten Familie, hereinstürmt und völlig verwirrt brüllt: „Ich soll sagen, ähhhm … Ja, da sind so Kinder, die gesagt haben, dass sie ihren Vater auf der Arbeit besuchen wollen oder so!“
Ich frage ihn: „Ja, und wo sind die bitte? Ich seh die hier nicht!“
Er entgegnet: „Die sind bei Colin, der hat mich doch zu euch geschickt!“
Och ne, solche Schwierigkeiten können wir jetzt echt nicht gebrauchen!
„Jane, was willst du mit denen machen?“, sage ich zu Jane. „Du bist die Chefin hier.“
Sie richtet sich an Norman: „Sag Colin, er soll die Kinder herbringen.“
In dem Moment öffnet sich die Tür und Colin steht davor. „Norman“, sagt er, „komm mit. Wir scheinen noch weitere ungebetene Gäste da draußen zu haben. Und an Jane gewandt ergänzt er: „Die Sache kriegen wir schnell erledigt. Wir kommen gleich wieder, Chefin. Dann bringe ich die Mädchen.“
Während Norman und Colin sich wieder vom Acker machen, frage ich Jane: „Schatz, und was hast du jetzt mit den Kindern vor?“
„Wir müssen erst mal rauskriegen, was die hier eigentlich wollen, mein Liebling. Du kannst sie ja später mal verhören“, entgegnet sie.
„Klar, mach ich“, verspreche ich. „Ich hoffe nur, die machen uns keinen Ärger. Den können wir gerade gar nicht gebrauchen.“
Jane nickt. Eine Weile stehen wir schweigend und hängen beide unseren Gedanken nach. „Wo Colin nur bleibt“, fragt Jane schließlich.
Da erst werfe ich einen Blick durch das kleine Fenster des Büros und sehe zwei Menschen, einen Mann und eine Frau, die auf dem Weg zu uns sind.
„Scheiße, das sind garantiert Bullen!“, versuche ich Jane mitzuteilen, ohne zu schreien. „Hör zu! Du musst hier weg, die erfahren nie, dass du auch in die ganze Sache verwickelt bist, ich überleg mir ne Story! Die sind bestimmt nicht nur wegen des Kraftwerks oder des Bergwerks hier, sondern wegen der Kinder, die hier angetanzt sind, ich wusste ja, dass die Probleme machen würden!“
„Aber ich kann dich nicht alleine hierlassen, Viktoria!“, meint Jane aufgewühlt.
Ich kann nicht zulassen, dass sie auch von der Polizei erwischt wird: „Doch, du musst gehen, vertrau mir! Kennst du noch unseren Geheimausgang für Notfälle?“
Jane nickt und fängt an zu weinen, doch ich kann mich jetzt nicht von Gefühlen überwältigen lassen, sie muss es hier wegschaffen. Ich sage: „Gut, nimm den, dann finden die dich nie! Ich liebe dich!“
Unter Tränen läuft Jane los, denn sie weiß, dass es sonst zu spät ist.
Kapitel 23: Elara
„Bist du dir immer noch sicher, dass wir hier lebend wieder rauskommen?“, flüstere ich Emilia zu.
„Mein Vater wird uns schon retten, da bin ich sicher!“, antwortet sie mir.
Ich habe solche Angst, wie kann Emilia nur so cool bleiben? Die haben bestimmt sonst was mit uns vor, ich meine die betreiben ein illegales, unterirdisches Kohlekraftwerk und sind auch irgendwie in den Mordfall des Journalisten verwickelt, da bin ich mir sicher. Und Ilias ist auch immer noch nicht aufgetaucht, wo steckt er nur? Ich ertrage das alles nicht mehr, es ist einfach zu viel für mich.
Plötzlich werden die Frauenstimmen aus dem Nebenraum lauter, die wir schon bevor Norman und Colin uns entdeckt und in diesen winzigen, leeren und kalten Raum gebracht haben das erste Mal gehört haben. Seit wir hier eingesperrt sind, habe ich die Stimmen immer mal wieder gehört, allerdings scheinen sie jetzt aufgeregt über irgendetwas zu diskutieren. Was wohl da los ist? Jetzt scheint jemand wegzulaufen und dann: „Sie sind verhaftet! Hände dahin, wo ich sie sehen kann!“
Da bleibt mir die Luft weg, die Polizei hat uns tatsächlich gefunden, Emilia hatte Recht.
Im nächsten Moment rufe ich: „Hallo, hier sind wir!“
Daraufhin kommt Emilias Vater mit seinen Polizeikollegen und -kolleginnen zu uns geeilt und sie machen sich umgehend daran, die Kabelbinder an unseren Händen aufzuschneiden. Emilia fällt ihrem Vater erleichtert in die Arme, ich kann eine kleine Freudenträne auf seiner Wange erkennen. Doch was dann passiert, hätte ich mir nicht träumen lassen, denn eine Polizistin betritt den Raum, und wen hat sie an der Hand? – Genau, Ilias! Ich renne, als würde ich um mein Leben laufen, zu ihm, knie mich vor ihn auf den Boden und schließe ihn in die Arme.
„Was machst du nur für Sachen?“, sage ich, vor Freude und Erleichterung weinend. „Wo warst du? Geht’s dir gut? Was ist passiert?“
„Ach Schwesterchen, ich hab dich auch vermisst! Mir geht es supi, und ich habe sogar einen Laubfrosch, einen Wasserfrosch und einen Teichfrosch kennengelernt. Aber wie geht es dir denn? Du musst hier in dieser riesigen Höhle doch wirklich Angst gehabt haben, oder?“, antwortet mir Ilias.
Mein leises Lachen unterbricht mein Weinen. „Ich bin einfach nur froh, dass du wieder da bist“, meine ich. „Du kannst mir gleich von den Fröschen erzählen, dann erzähle ich dir auch von meinem Abenteuer, ja?“
Er entgegnet: „Das machen wir so!“
Als wir gerade den Raum verlassen haben und auf dem Weg durch den Flur sind, ruft Ilias aufgeregt: „Sie ist das, die ich am Fluss gesehen hab! Sie hat den Mann ins Wasser geworfen!“, und zeigt dabei auf eine rothaarige Frau, die gerade durch den Flur geführt wird.
Die Polizisten, die der Frau sowieso schon Handschellen angelegt hatten, rücken näher an sie heran und versichern Ilias: „Wir versprechen dir, wir werden ein besonderes Auge auf sie haben!“
Das scheint Ilias zwar etwas zu beruhigen, allerdings wirkt er immer noch verunsichert. Ich bekomme Angst. Es scheint Ilias doch nicht ganz so gut zu gehen, wie er mir gerade gesagt hat, das scheint er verdrängt zu haben. Aber besser ich spreche ihn erst später darauf an, ich will ihn nicht noch weiter beunruhigen. Mir stellen sich unfassbar viele Fragen. Was hat Ilias da nur gesehen? Hat er tatsächlich den Mord beobachtet? Ich kann es nicht fassen! Geht es ihm wirklich gut? Kann er von einem solchen Erlebnis ein Trauma davontragen? Wie kann man es verdrängen, einen Mord beobachtet zu haben? Mein kleiner Bruder, er hat es nicht verdient, so etwas mitbekommen zu müssen! Hätte die Mörderin nicht wenigstens aufpassen können, wenn sie schon wen umbringen muss? Ich bin wütend auf die Frau, und ohnehin: In mir herrscht ein wahres Gefühlschaos. Mein Kopf dreht durch, es bringt alles nichts, ich muss mich beruhigen, vielleicht kann ich morgen reflektierter darüber nachdenken. Diesen Gedanken überdenke ich noch mal und stelle fest, wie naiv es von mir ist, zu glauben, dass ich meinen Kopf bis morgen einfach abschalten und meine Gefühle zurückstellen kann, dafür kenne ich mich zu gut. Aber eins kann ich versuchen: mich zu beruhigen, denn es bringt ja nichts, wenn ich jetzt auch noch hysterisch bin.
Kurze Zeit später laufen Emilia und ihr Vater genau wie mein kleiner Bruder und ich Hand in Hand die Einfahrt zum Kraftwerk hinauf ins Licht, denn mittlerweile lacht die Sonne sogar wieder, der Regen hat sich wohl in Luft aufgelöst. Während die ganzen Polizeileute noch die Verhafteten abführen, Personalien aufnehmen und das Gelände weiter absichern, erzählt mir Ilias von seinem Erlebnis mit der Froschbande und seinen Ideen dazu, was man gegen den Klimawandel unternehmen kann. Es macht mich total stolz, dass mein kleiner Bruder solche Themen auch schon wichtig findet und gute Ideen dazu hat. Außerdem überrascht mich seine blühende Fantasie immer wieder, ich kann echt froh sein, so einen tollen Bruder zu haben, hat nicht jeder! Nur die Tatsache, dass er nach eigener Aussage bei einem Lukas im Baumhaus übernachtet hat, beunruhigt mich etwas. Ob es diesen Lukas wirklich gibt? Was hätte Ilias im Wald alles passieren können? Ganz zu schweigen von der Tatsache, dass mein kleiner Bruder, ein sechsjähriger Junge, einen Mord beobachten musste. Es tut mir so leid für ihn und …, Nein, ich wollte meine Gedanken zurückstellen, ich kann jetzt keine schlechten Gefühle gebrauchen …
Ich habe auch keine Idee, wie ich das alles unseren Eltern erklären soll, die werden bestimmt außer sich sein. Ich hoffe, ich kriege keinen Hausarrest, aber egal, jetzt ist die Hauptsache, dass Ilias wieder da ist und es allen gut geht, das war ein anstrengender Tag. Dass ich so etwas mal erleben muss! Ich bin total müde, könnte so ins Bett fallen. Zum Glück hat John gesagt, wir müssen heute nicht mehr zur Polizeistation mitkommen.
Kapitel 24: Emilia
Angestrengt starrte ich auf den winzigen Bildschirm, der das Innere des kleinen Verhörraums offenbarte. Darin saß mein Vater Viktoria Reik gegenüber, und sie durchbohrten sich gegenseitig mit Blicken. Ob mein Vater wusste, dass ich hier war? Nö! Das ging ihn aus meiner Sicht auch nichts an. Immerhin hätte er ohne mich … na ja … ohne uns … überhaupt keine Verhaftete vor sich. Zu meinem Glück hatte der Raum eine Lautsprecheranlage, die es mir erlaubte, alles mitzuhören, was in dem Raum passierte. Ich grinste, als mir ein guter Gedanke kam. Neben mir stand ein Mikrofon, das geradezu nach mir zu rufen schien. So etwas konnte ich nicht ignorieren. Ich griff danach und wollte gerade laut hineinschreien, als das Verhör begann.
Das sah so aus, dass mein Vater sich wichtigtuerisch räusperte und Viktoria einen strengen Blick zuwarf. Diese erwiderte den Blick nicht, rümpfte aber genervt die Nase und änderte ihre Sitzposition zu einem trotzigen Schneidersitz.
„Warum bin ich überhaupt noch hier?”, fragte sie fauchend. „Von meiner Seite ist alles geklärt!” Sie fummelte dabei nervös an ihrem Ehering herum, streifte ihn dann nach kurzem Zögern ab und ließ ihn in ihre Handtasche gleiten. „Also?! Kann ich jetzt hier raus und zurück in meine Zelle?!” Sie verschränkte die Arme vor der Brust und drehte sich von der Tischlampe weg, die sie anscheinend blendete.
Dad schüttelte verständnislos den Kopf. „Sie wollen mir doch nicht weismachen, dass Sie das alles alleine geplant haben?”, fragte er und zog eine Augenbraue bis zum Haaransatz hoch. Über den kleinen Bildschirm konnte ich erkennen, wie eine Ader an seinem Kopf zu pulsieren begann. „Außerdem haben Sie immer noch nicht zugegeben, Kenny McAngus getötet zu haben … Aber Sie haben Recht! Solange Sie mich nicht aufklären, kann ich nichts mehr für Sie tun.”
Er stand laut seufzend auf, und ich sah meine Chance kommen. Wieder griff ich nach dem Mikro und schrie nun tatsächlich laut hinein: „HEY, DAD! SIEH DOCH MAL IN IHRER TASCHE NACH! VIELLEICHT KÖNNTE DICH DAS WEITERBRINGEN!!!”
Mein Vater sprang erschrocken in die Luft und begann zu schimpfen. Ich aber drehte die Lautstärke der Boxen auf Null und pfiff vor mich hin. Nach einigen Sekunden der „Stille“ schien Dad sich beruhigt zu haben und schüttelte nur noch verstört den Kopf. Dann aber begann er zu nicken. Ich drehte die Lautstärke etwas auf, sodass ich gerade noch mithören konnte. Jetzt ging mein Vater langsam auf den Stuhl zu, auf dem Viktoria ihren Ich-sage-nichts-Streik durchführte. Dann packte er blitzartig nach der kleinen, goldenen Handtasche und riss sie Viktoria aus den zu Fäusten geballten Händen.
Nur wenige Minuten später gab Viktoria ein Geständnis ab. Wie Papa alles aus ihr herausquetschen konnte? Na gar nicht! Kurz bevor er in ihre Tasche greifen konnte, brach sie aus ihrer Grummelstarre heraus in Tränen aus, sackte auf dem Boden zusammen und gab ihre Tat kleinlaut zu. Mein Vater gab seinen bösen Blick auf und versuchte dienstlich zu bleiben. Ich blieb natürlich total ernst. Ich meine ja nur! Wie konnte man bei einer Mörderin Mitleid bekommen?! Aber das Schauspiel, was sich mir bot, war schon sehr herzzerreißend. Ich fasse zusammen: Zuerst lag sie da einfach so rum und heulte, was sich etwas zu lang hinzog. Nachdem mein Vater ihr unsicher ein Taschentuch gereicht hatte und sie sich beide wieder gesetzt hatten, fasste sie sich wieder ein wenig. Dann erzählte sie, dass sie durchaus hatte vertuschen wollen, was Kenny McAngus über LIVE herausgefunden hatte. Aber dass die Entscheidung, ihn nicht bloß einzuschüchtern, sondern gleich zu töten, einem ganz anderen Motiv entsprungen war. Ab dem Moment hörte ich besonders gut hin, damit ich Elara nachher alles so detailgetreu wie möglich wiedergeben konnte.
„Alles begann eigentlich schon vor zwölf Jahren“, sagte sie. „Was ich Ihnen aber … schluchz … nicht alles erzählen möchte. Fangen wir vor einem halben Jahr an. Ich bin schon seit vierzehn Jahren geoutet und lebe seit zwölf Jahren zusammen mit meiner Chefin … schluchz … Jane. Sie ist sozusagen meine Auftraggeberin, und wir arbeiten zusammen. Sie ist der Boss, der hinter allem steht! Aber sie hat mich nicht damit beauftragt, Kenny zu töten, das schwöre ich!”
Mein Vater musterte Victoria kurz. „Was ich aber nicht begreife … Sie sagten eben selbst, dass es sicherlich gereicht hätte, Kenny McAngus viel Geld zu bieten oder ihn einzuschüchtern, damit er seinen Artikel über die illegalen Machenschaften von LIVE nicht veröffentlicht hätte. Warum haben Sie ihn trotzdem … Sie wissen schon?”
Viktoria verzog angewidert das Gesicht: „Er war Abschaum! Er lebte in der Vergangenheit! Er war ein neugieriges Schwein, das seine Nase in anderer Leute Angelegenheiten steckte! Und wenn man da nicht aufpasst, kann einem die Nase eben auch schon einmal abgebissen werden. Er hat Jane und mich nicht wie Menschen behandelt! Er war immer angewidert in unserer Umgebung und machte einen großen Bogen um uns. ER HAT UNSERE LIEBE NICHT VERSTANDEN!“
Dad schüttelte nur irritiert den Kopf, ehe er Viktoria bat, den Tathergang ausführlich zu schildern.
Kapitel 25: Viktoria – Rückblende
Ich schlich, so leise wie ich konnte, hinter Kenny her in den Wald.
„Hast du dich verlaufen, Viktoria?“, fragte er plötzlich und drehte sich zu mir um.
„Guter Witz“, meinte ich trocken und versuchte, mir die Überraschung darüber, dass er mich erwischt hatte, nicht anmerken zu lassen.
Ich winkte ab und lief dann extra in anderer Richtung weiter. Ich beobachtete, wie Kenny weiter am Fluss entlangging, und schlich ihm diesmal noch weiter entfernt nach, bis er direkt am Ufer stehenblieb. Ich wusste aus irgendeinem Grund, dass das meine Chance war. Ich überlegte also nicht lange, griff in meine Tasche, zog das Messer hervor und sprang aus meinem Versteck. Ich sprang direkt auf Kennys Schultern und warf ihn mit voller Kraft um. Durch die Wucht flog sein Hut vom Kopf in den Matsch.
Kenny lag auf dem Rücken und blickte zu mir auf. Er sah mir direkt ins Gesicht und meinte tonlos: „Ohh…kay, ich denke, das ist dann kein Freundestreffen.“
„Sah es für dich jemals so aus?“, fragte ich und hielt ihm das Messer unter die Nase.
Er riss voller Angst die Augen auf und schrie: „N-nein, bitte nicht … W-wir können doch über alles-alles reden. D-du hast n-nicht das vor, w-was ich d-denke, oder?“
Ich blickte von seinen Augen weg auf seinen Körper und tat, was ich tun musste. „Jetzt denkst du nichts mehr“, sagte ich dann.
Ich hörte ein Knacken und schaute mich nervös um, sah aber nichts Außergewöhnliches. Sicher ein Tier, dachte ich und rannte, so schnell mich meine Beine trugen, davon. Mein einziger Gedanke war, zurück zu LIVE, zurück zu Jane, zurück nach Hause.
Kapitel 26: die Familie
Am Abend saß die Familie von Elara und Ilias ein weiteres Mal im schönen Garten zusammen und sprach über die vergangenen beiden Tage.
Die Mutter fragte: „Wie ist es denn gelaufen? Hattet ihr irgendwelche Probleme, oder war alles in Ordnung?“
Elara und Ilias hatten nach den aufregenden Ereignissen vereinbart, ihren Eltern nichts davon zu erzählen. So würden die sich nämlich nicht aufregen oder sich Sorgen machen, dass sie in Gefahr geraten sein könnten (was ja in der Tat der Fall gewesen war), beziehungsweise würden Elara und Ilias so keinen Ärger bekommen.
Deshalb antwortete Elara: „Alles war normal. Wir hatten gar keine Probleme oder so.“
„Das ist doch schön. Dann brauchen wir ja überhaupt keine Babysitter für euch mehr zu suchen“, stellte die Mutter klar. Doch nun kam die Überraschung: „Das war nämlich eigentlich nur eine Probe. Wir wollten ausprobieren, wie ihr so alleine klarkommt. Falls ihr Probleme gehabt hättet, hätten wir sofort kommen können. Wir waren nämlich eigentlich nur in Marl.“
Nun regte sich Elara lautstark auf: „Was? Ihr wart die ganze Zeit nur in der Nachbarstadt? Dann hätte ich mir ja den Aufwand, auf Ilias aufzupassen, sparen können.“
„Jetzt beruhige dich mal!“, wandte ihr Vater ein. „Du hast doch gerade selbst gesagt, dass es keine Probleme gab. Das heißt doch auch, dass Ilias gar nicht so aufwendig zu ‚bändigen’ war. Und außerdem …“
Da klingelte das Telefon, und der Vater hechtete schnell hin.
Der Rest der Familie hörte nur: „Ah. Hallo John. Was ist denn? … … Hä? Wer ist denn bitte schön Victoria Reik? … … Was für ein Abenteuer denn? … … Was?! Eins meiner Kinder war verschollen? Beide haben bei der Detektivarbeit geholfen, sind zwei Verbrecherinnen hinterhergejagt, von denen die eine eine Mörderin ist, und meine Tochter ist auch noch von denen gefangen genommen worden? Das ist ja interessant. Mit meinen Kindern muss ich wohl gleich noch mal sprechen. … Ach, keine Sorge. Sie werden es dir schon verzeihen. … Alles klar. Richte ich aus. Tschüss.“ Dann legte er auf und warf erst Elara und dann Ilias einen verärgerten Blick zu. Das würde wohl Ärger geben …
Das Projekt
Diese Geschichte entstand in den Osterferien 2021 als Nachfolgeprojekt der Projekte „Am Fluss“ und „Am Fluss II“, mitten in der dritten Corona-Welle. Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Maßnahmen: In fünf Videokonferenzen planten, diskutierten und schrieben die neun Autorinnen und Autoren ihre gemeinsame Geschichte und die einzelnen Kapitel gemeinsam mit der Workshopleiterin Sarah Meyer-Dietrich und präsentierten sie in einer Abschlusslesung. Unterstützung gab es wie bereits im Vorjahr von Birgitt Hülsken von der Stadtbibliothek Dorsten.
Das Projekt wurde ermöglicht durch Schreibland NRW und den Lippeverband und organisiert und durchgeführt von der Stadtbibliothek Dorsten.
Die Autorinnen und Autoren
Kapitel 1: Simon Woitinas
Kapitel 2: Levje Schmadel
Kapitel 3: Finn Droste
Kapitel 4: Levje Schmadel
Kapitel 5: Finn Droste
Kapitel 6: Merle Gabriele Dückers
Kapitel 7: Levje Schmadel
Kapitel 8: Clara Kunzmann
Kapitel 9: Nele Hülsmann
Kapitel 10: Emma Clausen
Kapitel 11: Simon Woitinas
Kapitel 12: Nele Hülsmann
Kapitel 13: Dana Loup
Kapitel 14: Dana Loup
Kapitel 15: Emma Clausen
Kapitel 16: Emma Clausen
Kapitel 17: Emma Clausen
Kapitel 18: Finn Droste
Kapitel 19: Kilian Pieck
Kapitel 20: Levje Schmadel
Kapitel 21: Merle Gabriele Dückers
Kapitel 22: Merle Gabriele Dückers
Kapitel 23: Merle Gabriele Dückers
Kapitel 24: Nele Hülsmann
Kapitel 25: Kilian Pieck
Kapitel 26: Simon Woitinas
Illustrationen: Finn Droste (Cover), Merle Gabriele Dückers (Kapitel 6, Bild 1 und Kapitel 8), Levje Schmadel (Kapitel 6, Bilder 2 und 3)
Sabine Fischer-Strebinger
Streuobstwiesen bieten eine hohe Attraktivität für Erholungssuchende, Dorstener und Touristen
m Frühjahr gehören blühende Streuobstwiesen sicherlich zu den schönsten Ausflugszielen in der Natur. Von Mitte April an zeigen die Bäume ihre Blütenpracht, beginnend mit der Kirschblüte. Darüber hinaus tragen die Blumen auf den Wiesen zur bunten Farbenpracht bei.
Eigentlich wurden Obstbäume früher an landwirtschaftlich weniger nutzbaren Standorten gepflanzt, verschwanden infolge der Intensivierung der Landwirtschaft im 20. Jahrhundert und sind inzwischen auch aus Gründen des Naturschutzes wieder ein wichtiges Thema.
Für das Stadtgebiet Dorsten gibt es eine Erfassung der öffentlich oder teilweise öffentlich zugänglichen Streuobstwiesen, die in diesem Buch anhand einer Karte dargestellt sind. Die Dorstener Streuobstwiesen laden zu einem Ausflug durch das Stadtgebiet ein. Wer gerne wandert oder mit dem Rad in der Natur unterwegs ist, kennt sicherlich schon einige Streuobstwiesen unserer Stadt. Warum nicht mal im Frühling eine Blütenrundfahrt starten. Fahrten und Wanderungen entlang der Streuobstwiesen sind bis in den Herbst hinein möglich und auch in der kalten Jahreszeit haben die Streuobstwiesen viel zu bieten, insbesondere aber ihre Produkte. Im Winter brauchen die Bäume z.B. einen Schnitt und die Biologische Station in Lembeck, die Volkshochschule Dorsten und der RuhrKulturGarten in Altendorf-Ulfkotte bieten Kurse für Interessierte zum richtigen Baumschnitt an.
Auch Führungen werden von den Besitzern einiger Streuobstwiesen angeboten. Je nach Ort erhalten die Besucher Informationen über die Obstbäume, die Sortenwahl, die Pflege, Insekten, geschützte Tierarten oder die biologische Vielfalt. Auch die Verarbeitungskette hat für den Streuobstwiesenbesucher viel Interessantes zu bieten. Viele leckere Gerichte und Getränke lassen sich aus Äpfeln, Birnen, Nüssen, Mirabellen und Beeren zaubern und die kulinarischen Produkte der Streuobstwiesen werden in Hofläden angeboten und dürfen verkostet werden. Die Wiesen bieten zu jeder Jahreszeit ein reiches Angebot an Köstlichkeiten.
Sebastian Cornelius, Klimaschutzbeauftragter der Stadt Dorsten
Ein Kommentar
Zu meiner Person: Seit September 2018 bin ich bei der Stadt Dorsten in der Position des Klimaschutzmanagerstätig. Ich habe Geographie an der Universität Münster studiert und beschäftigte mich bereits früh im Rahmen dessen mit den Themenfeldern Klimawandel, Klimaschutz und Nachhaltigkeit.
Ich habe die Beiträge, die hier über die Leselounge verfasst wurden mit Freude, aber auch zum Teil mit Besorgnis gelesen. Insbesondere die Texte, in denen Ängste geäußert werden, stimmen mich nachdenklich. Diese haben mich aber auch dazu ermutigt, selbst einen Beitrag zu verfassen und meine Sichtweite aus beruflicher Perspektive darzulegen, wie wir gemeinsam mit der wohl größten gesellschaftlichen Herausforderung der Menschheit umgehen.
Zum Zeitpunkt meines Arbeitsbeginns bei der Stadtverwaltung im Jahr 2018 wurde das Thema Klima- und Umweltschutz in der Verwaltung nicht gänzlich neu erdacht.
Seit vielen Jahrzehnten befindet sich das Thema auf dem politischen Parkett mit all seinen Facetten und daraus abgeleiteten bzw. erforderlichen Maßnahmen. Erstmalig in den 1980er Jahren, explizit durch die Reaktorkatastrophe des Atomkraftwerks der ukrainischen Stadt Tschernobyl angetrieben, international konkretisiert durch die Klimakonferenz in Rio de Janeiro 1992 und das daraus entwickelte Kyoto-Abkommen 1997, befand sich das Thema des Klimaschutzes als Teil eines umfassenden Umweltschutzgedanken immer in einem Auf und Ab. So auch im Jahr 2009, als ein verheerendes Erdbeben ein Atomkraftwerk im japanischen Fukushima stark beschädigte, wodurch enorme Mengen Strahlung austraten und die deutsche Regierung in Folge dessen beschloss alle deutschen Atomkraftwerke nach und nach abzuschalten.
Viele der genannten Vorfälle die national und international für Aufmerksamkeit sorgten, fanden natürlich auch innerhalb der Stadt Dorsten und der Verwaltung Gehör. Dazu wurden Informationen und Projekte erarbeitet sowie zahlreiche Gespräche mit unterschiedlichsten Akteuren geführt.
Viele Jahre eines klimapolitischen Hoch- und Tiefs in Deutschland und auch eine unterschiedliche Gewichtung auf dem politischen Parkett nahmen hierbei natürlich Einfluss.
Der Themenbereich des Klimawandels und die daraus entstehenden Folgen haben mich in meiner Studienzeit sehr bewegt. Die einhergehenden vielfältigen Recherchen und die pure Neugier am Thema motivierten mich dazu, mein Studium explizit in diese Richtung zu lenken und meine berufliche Laufbahn auf den Bereich Klimaschutz- und Klimaanpassung auszurichten.
In den bereits nun vier Jahren seit meinem Amtsantritt als Klimaschutzmanager habe ich viele unterschiedliche Personen, Institutionen und Projekte kennenlernen dürfen. Es wurden bereits viele Projekte gemeinsam erarbeitet oder z.T. auch neu gedacht. Es waren auch Ideen darunter, die schon vor vielen Jahren thematisiert und dann auch umgesetzt wurden, ihre Aktualität aber seitdem nicht verloren haben.
Was mich dabei besonders geprägt hat, ist die Sichtweise, die ich seitdem auf das Themenfeld Klimaschutz erhalten habe. War ich im Studium noch häufig ein Verfechter radikalerer Ansichten und durchaus auch mal Kritiker der Politik, der Verwaltung und mancher Unternehmen, denen ich vorwarf, die Themen nicht denken zu wollen, so begann ich zunehmend zu verstehen, dass bereits an vielen Stellen seit längerer Zeit gearbeitet wurde. Dabei wurde auch deutlich, dass viele Probleme wesentlich vielschichtiger sind, als ich es lange Zeit annahm. Es erfordert häufig eine Vielzahl an Personen auf unterschiedlichsten Ebenen um ein Thema anzustoßen und erfolgreich vorantreiben zu können.
Unwissenheit einzelner oder gar vieler Personen verleitet allgemein schnell zu einem doch recht ausgeprägten „Schwarz-Weiß-Denken“ und endet nicht selten in polemischem Raunen über die „Übeltäter“ und viele in den Raum geworfene Vorwürfe. Änderungen und Überzeugungen werden von Menschen meist nur dann wirklich verinnerlicht, wenn Sie einerseits einen Grund nachvollziehen können und andererseits – dies ist vermutlich wesentlich bedeutender – eine unmittelbare Betroffenheit spüren.
Hierbei ist es auch in meinem Job wichtig, herauszustellen, dass die Änderung im Verhalten oder auch eine mögliche Investition etwas Gutes für die betroffenen Personengruppe, eine Institution oder ein Unternehmen sein kann. Ob es nun Gewohnheiten sind, ein Umdenken in der Art und Weise eines Tuns oder ganz einfach Dinge auf den Weg zu bringen. Dabei muss man zeitgleich aufzeigen, was machbar ist, auch – entgegen vieler Befürchtungen – ohne wesentliche Einschränkungen hinnehmen zu müssen und am Ende sogar einen Mehrwert auf mehreren Ebenen zu schaffen.
Diese Erkenntnis muss jeder für sich selbst erlangen in Form einer Überzeugung, einer veränderten Grundeinstellung. So ist es für ein Unternehmen z.B. durchaus auch wirtschaftlich sinnvoll, in Klima- und Umweltschutzmaßnahmen zu investieren, um langfristig auch von erheblichen Kosteneinsparungen profitieren zu können. Der in der Klimaschutz-Kommunikation oft angeführte Begriff der “Nachhaltigkeit“ schließt dabei im Regelfall auch eine wirtschaftliche Nachhaltigkeit mit ein.
Man muss sich in der Rolle als Verwaltungsmitarbeiter_in auch mal unangenehmen Situationen stellen und manchmal bleibt es nicht aus, klare Regeln und Richtlinien zu fordern, die alte Muster aufbrechen. Dies kann Geduld erfordern, insofern viele unterschiedliche Bereiche und Akteure involviert sind.
Ebenso gibt es auch Problemstellungen, die es mir und anderen Kollegen_innen nicht erlauben, direkt einzugreifen. Dennoch informiert man sich und man tritt mit den Bürgern und beteiligten Akteuren in den Dialog, um eine gemeinsame Lösung zu finden. Auch das ist eine Aufgabe, die mir sehr am Herzen liegt und für die ich meine Arbeit schätze.
Ich blicke positiv auf die vergangenen Jahre und die bereits umgesetzten Maßnahmen bzw. die angestoßenen Projekte, die während meiner Zeit begleitet oder unmittelbar bearbeitet werden konnten, auch wenn z.T. noch einiges zu tun ist bis wir die Ziele erreicht haben die wir uns als Gesellschaft national und international gesetzt haben.
Umso mehr freut es mich aber zu sehen, wie aktiv viele Bürger_innen bereits seit vielen Jahren sind und aktiv Projekte vorantreiben, die es der nachkommenden Generation ermöglichen sollen, auf eine lebenswerte Umwelt zu stoßen und ein Bewusstsein für diese zu schaffen.cornelius
