Lebenlassen!
Texte zur Biodiversität
Seit Oktober 2025 macht die Installation LEBENLASSEN! am Rückläufigen Hambach in Dorsten Holsterhausen auf eines der drängendsten Probleme unserer Zeit aufmerksam: Das Aussterben der Arten und der damit verbundene drohende Verlust unserer Ernährungsgrundlage. Bereits seit Beginn des Jahres 2021 sammeln wir Texte zur Biodiversität und zum Klimawandel. Beides sind existenzielle, miteinander verwobene Themen, die auch hohe Relevanz für EGLV haben, weil mit der Arbeit an den Gewässern die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Agenda 2030 der Vereinten Nationen unterstützt werden. Literarisch sind die hier zusammengestellten Texte sehr vielfältig. Von Sachtexten zu Renaturierung und Artenvielfalt über philosophische Essays, Schulprojekte, Arbeitsergebnisse der Biologischen Station Recklinghausen bis zu Streuobstwieseninitiativen zeigen uns Autor*innen aus der Lipperegion ihre Sicht auf eine der größte Krisen unserer Zeit.
Augmented Reality
Lass die Libellen fliegen! Link mit Handy oder Tablet öffnen und die Libellen in der Umgebung schwirren lassen:
INHALT
Hans Kratz: Ohne die Natur haben wir keine Zukunft
Dörthe Huth: Tage ohne Insekten
NABU|naturgucker-Akademie: Natur an der Lippe erkunden und erleben
Neue Schule Dorsten (UNESCO-Schule): Tiere an Gewässern
Bündnis Artenvielfalt NRW: Forderungen
NABU (Naturschutzbund Deutschland) e.V.: Grundsatzprogramm Artenvielfalt
Klaus-Dieter Krause (Nabu Dorsten): Was Kröte, Molch und Frosch sich erzählen
Petra Nitschke-Kowsky: Storchenberichte aus dem Hervester Bruch. Unornithologische Beobachtungen
Horst Papenfuß & Michael Drescher: Wie die „Auerochsen“ nach Hervest zurück kamen
Ina Bernds, EGLV Meisterin Gewässer Westliche Lippe: Interview
Georg Tenger: Erhalt von heimischen Streuobstwiesen
Hans Kratz
Ohne die Natur haben wir keine Zukunft
Einer meiner ganz persönlichen Glücksmomente in diesem Dasein gestaltet sich nach folgendem Szenario: Ich knie im Garten vor einem Beet, vertieft in irgendeine gärtnerische Tätigkeit. Außer dem Geruch der Erde, den Pflanzen um mich herum, der Sonne auf meinem Rücken gibt es da für mich nichts weiter. In dieses entspannt-sinnfreie Hantieren am Beet mischt sich unvermittelt das unverkennbare Brummen einer Hummel. Irgendwo nahe bei mir, am Kopf, hinter meinem Rücken, neben mir. Bin ich ihr lästig? Oder willkommen? Störe ich ihre Kreise? Oder wecke ich ihre Neugier? Es ist mir völlig einerlei, denn wir beide sind uns zu fremd, als dass ich mir anmaßen dürfte, zu wissen, was diese wollig, gemütliche Brummschaukel gerade empfindet. Trotzdem überkommt mich in diesem Moment stets eine tiefe Ruhe und Zufriedenheit. Es ist die Ahnung, dass wir beide in demselben sehr komplexen, weit verzweigten Netz wechselseitiger Abhängigkeiten eingewoben sind. Ein Netz, in dem jede Kreatur ihren Job macht, und zwar so, dass dieses vieldimensionale Knüpfwerk keinen Schaden nimmt.
Die Hummel tut dies, indem sie bis zu 18 Stunden am Tag (Honigbienen schaffen nur 12) von Blüte zu Blüte fliegt, Nektar sammelt und dabei sehr effizient alles, was Blüten trägt, bestäubt. Sie beginnt damit schon bei deutlich niedrigeren Temperaturen als unsere Bienen und ergänzt sich so mit diesen zu einem hervorragenden Team. Aus mehrjährigen wissenschaftliche Untersuchungen weiß man, dass Bienen, Wildbienen und Hummeln durch ihre Arbeit den Ertrag einer Obstbaumplantage im
Durchschnitt vervierfachen.
Wir Menschen sind als Organismus deutlich komplexer gestaltet und daher benötigen wir gegenüber der Hummel ein deutlich komplexeres Netz von Wechselwirkungen mit der uns umgebenden Biosphäre. Leider hat uns die Evolution diese Tatsache und die daraus sich ergebenden Notwendigkeiten weder in unser Bewusstsein noch in unser Triebverhalten geschrieben. Unsere Beziehung zur Natur ist geprägt von Gier, Dummheit und Trägheit. Oder etwas freundlicher ausgedrückt: Menschen fallt es schwer, sich selbst zu begrenzen, und es mangelt ihnen oft an Empathie anderen Arten gegenüber, vor allem jenen Geschöpfen, denen sie ihre Wildheit längst weggezüchtet haben. Der Mensch tötet sehr viel, aber nicht mehr um zu überleben, eher ist es eine Art Gewohnheitsraserei. Allein in Deutschland werden pro Jahr 650 Millionen Hühner, 53 Millionen Schweine und 53 Millionen Puten absichtlich getötet. Zukünftige Generationen werden auf diesen Umstand mit einem vergleichbaren Abscheu zurückblicken, wie wir heute auf die unsäglichen Grausamkeiten in den römischen Zirkusarenen oder während der Zeit der Hexenverfolgung.
Weil es mehr Menschen gibt und weil diese immer mehr essen, besitzen, verbrauchen wollen, braucht die Menschheit immer mehr Raum. Für Moor, Wıesenvögel, Elefanten und Thunfische bleibt folglich immer weniger Platz. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schätzen, dass alle zehn Minuten eine Art ausstirbt: Meistens unbemerkt, denn von den geschätzt neun Millionen Tier-, Pilz- und Pflanzenarten sind erst zwei Millionen wissenschaftlich beschrieben worden.
Wir haben weltweit zwei Drittel weniger Tiere als noch im Jahr 1970. Bei den Insekten sind die Zahlen im gleichen Zeitraum um mehr als 75 Prozent eingebrochen – und das allein in Deutschland. Drei Viertel der Landfläche haben wir Menschen nach unseren Bedürfnissen umgestaltet, und zwei Drittel aller Meere sind von unserem Einfluss gezeichnet. Die Fläche von Städten hat sich seit 1992 verdoppelt, die Verschmutzung durch Plastik seit 1980 verzehnfacht. Viele Populationen von Tieren und Pflanzen sind so dezimiert, dass diese auch dann aussterben würden, wenn wir sofort umsteuern würden (was wir leider nicht tun).
Zurück zu meiner Hummel, die lateinisch Bombus heißt und die mich damit an die lustigen Bommel an den Wollmützen unserer Enkelkinder erinnert. In der Dorstener Zeitung vom 03.03. 2023 las ich mit Schrecken, dass auch ihre Existenz mehrfach bedroht ist. Die Gründe: Die Zerstörung ihrer Lebensräume und Hitzestress während der bei uns immer häufiger auftretender Dürreperioden. Die Deichhummel (Bombus distinguendus), die einst bei uns sehr verbreitet war, wird sogar als stark gefährdet eingestuft. Ihr dicker flauschiger Pelz dürfet ihr in Zeiten globaler Erwärmung zum Verhängnis werden.
Laut neuestem UNO-Bericht vom 27. 10. 2022 sind wir weit von dem Ziel des Pariser Abkommens entfernt, die globale Erwärmung auf deutlich unter 2 °C, vorzugsweise 1,5 °C, zu begrenzen. Die derzeitige nationale und internationale Politik deutet auf einen Temperaturanstieg von 2,8 °C bis zum Ende des Jahrhunderts hin. Das bedeutet für Deutschland und damit auch für Dorsten eine Erhöhung der Jahresdurchschnittstemperatur um 3,6°C. In zwei von drei Sommern wird dann das Eis der Arktis verschwunden sein. 50% der Insekten werden mehr als 50% ihres Lebensraums verlieren. Trockenperioden werden in der Regel mehr als 11 Monate länger sein als heute. Die Fläche, die jedes Jahr im Mittelmeerraum Waldbränden zum Opfer fallen wird, sowie das Risiko eines Hochwasserereignisses werden sich verdoppeln. Die Korallenriffe werden vollständig ausgebleicht sein. Mehr als 50% der Weltbevölkerung wird an mehr als 20 Tagen im Jahr Temperaturen ausgesetzt sein, die gesundheitsgefährdend sind.
Das alles wissen wir, doch gefühlt ist der katastrophale Einbruch für uns eine Sache von morgen. Was ist hier und jetzt mit uns eigentlich los? Sollten wir nicht alles tun, um das anrollende Desaster so gut es geht in seiner Wirkung abzuschwächen?
Für die Hummel, die die Erhöhung der Durchschnittstemperaturen nicht zu verantworten hat, würde dies jetzt und hier zweierlei bedeuten: Die Schaffung vielfältiger Nahrungs- und Lebensräume etwa durch die Anlage von Streuobstwiesen (statt der vielen Schotterflächen in den Vorgärten) und die radikale Reduzierung unserer Konsumbedürfnisse, um den damit verbundenen CO2-Ausstoß drastisch zu senken.
Bei der Schaffung insektenfreundlicher Lebensräume sollten wir auf die Nutzung alter Sorten setzen, denn wenn Gemüse- und Zierpflanzen über Generationen in einer Gegend angebaut und vermehrt werden, passen sie sich dort an Klima und Boden an. Auf diese Weise haben lokale Sorten ihr eigenes Erbgut mit individuellen Eigenschaften entwickelt. Sie gedeihen gut im lokalen Klima und sind gegen Schädlinge und Krankheiten weniger anfällig. Diese Sorten bewahren eine große genetische Vielfalt und sind als lebendiges Kulturerbe sowie als Gen-Ressource sehr wertvoll. Alte Nutz- und Zierpflanzen müssen daher frei angebaut, vermehrt, getauscht und gehandelt werden können. Alle haben das Recht, diese Sorten weiterhin anzubauen und zu vermehren. Schmetterlinge, Bienen und Hummeln finden an den blütenreichen Stauden und Sommerblumen reiche Nahrung.
Im Grunde liegt es an uns allen. Jeder muss sich jetzt entscheiden, ob unsere Spezies auch in Zukunft noch einen Platz im wunderbaren Wirkungsnetz der Natur haben wird. Sind die Hummeln erst verschwunden, wird es für uns ziemlich eng.
Dörthe Huth
Tage ohne Insekten
Hornissen sah ich zuletzt vor einem Jahrzehnt
Auch Bienen und Libellen vermisse ich
Damals konnten wir nicht im Garten sitzen
Ohne dass ein schwirrendes Insekt versuchte
Uns den Apfelsaft streitig zu machen.
Nun ist die Luft ruhiger geworden
Die Tränen der Erde sammeln sich am Boden
Als steigender Meeresspiegel
Die einen ertrinken in Regenfallen
Die anderen werden trockengelegt
Unsere Aussichten für den Sommer
Liegen bei einer neuen Heißzeit
Die Quellen versiegen und
Der Geruch von Fäulnis
Steigt aus den Brunnen
Der Tod tilgt das Leben
Aber noch atmet die Erde
NABU|naturgucker-Akademie:
Natur an der Lippe erkunden und erleben
Im Vergleich zu vielen ihrer Nachbarflüsse hatte die Lippe in der Vergangenheit mehr Glück. Sie wurde deutlich weniger durch menschliche Eingriffe verändert und präsentiert sich deshalb an vielen Stellen noch immer oder wieder sehr naturnah. Mehrere Auen entlang des Flusses stehen unter Naturschutz und bieten so einen wichtigen Lebensraum für teils selten gewordene Tier-, Pflanzen- und Pilzarten.
Obwohl es in puncto Wasserqualität noch Verbesserungsbedarf gibt – in den letzten Jahren wurden an einzelnen Messstellen immer wieder erhöhte Nitratwerte festgestellt –, kann sich die Vielfalt der Wasserlebewesen sehen lassen.
Für alle, die sich für die Natur interessieren, ist die Lippe ein lohnendes Ziel für Erkundungstouren. Was Sie dort entdecken können und wie Naturbeobachtungen am besten gelingen, erfahren Sie in diesem Beitrag.

Naturnahes Steilufer an der Lippe bei Eversum, Foto © Monika Gehrke/NABU-naturgucker.de
Lippenatur an Land
Entlang der Lippe gibt es faszinierende Biotope zu entdecken, darunter Weiden-Ufergehölze. Hier dominieren Weiden mit ihrem weichen Holz, wie die Silber-Weide (Salix alba) mit ihren silbrig schimmernden Blättern und die strauchartig wachsende Korb-Weide (Salix viminalis).
Schon im zeitigen Frühjahr ziehen die Weidenblüten zahlreiche Insekten an. Unter anderem Wildbienen und Schmetterlinge finden dort Nektar. Die Blätter der Weiden sind zudem eine wichtige Nahrungsquelle für verschiedene Blattwespen- und Blattkäferarten. An den Stämmen älterer Weiden wachsen oft auch Pilze, zum Beispiel der auffällig gelbe Schwefelporling (Laetiporus sulphureus).

Silber-Weide, Foto © Stephanie Krämer/NABU-naturgucker.de

Gemeiner Schwefelporling, Foto © Christine Laumann/NABU-naturgucker.de
Ein weiterer wertvoller und artenreicher Lebensraum sind die Röhrichtbestände. Wer genau hinsieht und hinhört, kann im Schilf (Phragmites australis) besonders im Sommerhalbjahr viele Vögel entdecken, die dort brüten oder Nahrung suchen. Einige Arten, wie der Sumpfrohrsänger (Acrocephalus palustris) und der Teichrohrsänger (Acrocephalus scirpaceus), nutzen das dichte Grün gern als Versteck. Obwohl man diese kleinen, braunen Vögel nur selten sieht, ist ihr Gesang im Frühling ein typisches Geräusch an vielen Stellen des Lippe-Ufers.
In Ufernähe gedeihen und blühen Pflanzen wie das Echte Mädesüß (Filipendula ulmaria), der Gewöhnliche Gilbweiderich (Lysimachia vulgaris) und die aromatische Wasser-Minze (Mentha aquatica). Sie ziehen Insekten an, die dort Nektar und Pollen sammeln oder einfach eine Pause einlegen. Mit etwas Glück lassen sich hier auch die zierliche Blaue Federlibelle (Platycnemis pennipes) oder die schillernde Gebänderte Prachtlibelle (Calopteryx splendens) entdecken. Im Frühling und Sommer sonnen sich zwischen den Pflanzen oft Frösche am Boden, die jedoch bei Annäherung schnell ins Wasser springen.
Diese Beispiele geben einen kleinen Einblick in die beeindruckende Artenvielfalt an den Ufern der Lippe. Wer seinen Blick weiter schweifen lässt – aufs oder ins Wasser –, kann noch viel mehr entdecken!

Blüht im Juni und Juli: das Echte Mädesüß, Foto © Hans Schwarting/NABU-naturgucker.de

Männliche Gebänderte Prachtlibelle, Foto © Klaus Ashoff/NABU-naturgucker.de
Lippenatur im Wasser
In der Lippe leben Fische wie zum Beispiel die Groppe (Cottus gobio) und die Nase (Chondrostoma nasus), die aber meist schwer zu entdecken sind. An flachen Stellen mit klarem Wasser können Sie jedoch Glück haben und manchmal Jungfische sehen. Wesentlich auffälliger sind die nur wenige Millimeter großen Wasserläufer, die mit schnellen Bewegungen über die Wasseroberfläche flitzen. Diese Wanzen besitzen lange Beine, die ihr Gewicht so verteilen, dass sie nicht untergehen – eine bemerkenswerte Anpassung an ihren nassen Lebensraum.
Auch verschiedene Wasserpflanzen sind in der Lippe zu finden. Die Gelbe Teichrose (Nuphar lutea) zieht mit ihren schwimmenden Blättern viele Tiere an: Libellen nutzen sie als Ansitz, Wasserläufer ruhen sich dort aus und für den Seerosen-Blattkäfer (Galerucella nymphaeae) sind sie die ideale Nahrungsquelle.

Die Gelbe Teichrose ist eine wichtige Nahrungspflanze des Seerosen-Blattkäfers – das verraten die typischen Fraßspuren. Fotos © Gaby Schulemann-Maier/NABU-naturgucker.de
Vögel wie der Haubentaucher (Podiceps cristatus) und der Eisvogel (Alcedo atthis) jagen Fische im Fluss. Der Höckerschwan (Cygnus olor) hingegen ist überwiegend Vegetarier und ernährt sich von Wasserpflanzen. Dagegen ist die Stockente (Anas platyrhynchos) ein Allesfresser und ernährt sich sowohl von Pflanzen als auch von kleinen Tieren wie im Wasser lebenden Schnecken und kleinen Fröschen oder Kaulquappen.
Zudem verbringen unzählige Insekten ihr Larvenstadium im Wasser. Zum Beispiel bauen viele Köcherfliegenlarven bauen kleine, röhrenförmige „Gehäuse“ als Schutz vor Fressfeinden. Mit etwas Glück können Sie diese „gepanzerten“ Larven an flachen Stellen im Wasser entdecken. Vielleicht sehen Sie auch eine Eintagsfliegenlarve durchs Wasser gleiten, oder eine der gut getarnten Libellenlarven verrät ihre Anwesenheit, weil sie sich kurz bewegt.

Haubentaucher spielen oft „Wassertaxi“ für ihre Jungen, Foto © Sabine Frey/NABU-naturgucker.de

Die Larven vieler Köcherfliegen-Arten leben in selbst gebauten, schützende Röhren aus Pflanzenteilen und anderen Partikeln, Foto © Gaby Schulemann-Maier/NABU-naturgucker.de
Tipps fürs Beobachten der Natur
Um die Natur gezielt zu erkunden, kann die passende Ausrüstung sehr nützlich sein. Ein Fernglas oder Spektiv hilft dabei, entfernte Objekte klarer zu erkennen. Vor allem bei der Vogelbeobachtung sind diese Geräte verlässliche Helfer. Für das Beobachten von Schmetterlingen und anderen kleinen Tieren gibt es sogar spezielle Insekten-Ferngläser.
Wenn Sie sich nicht nur selbst an Ihren Entdeckungen erfreuen möchten, sondern Ihre Beobachtungen auf einem Portal für Naturbeobachtungen melden und somit mit anderen Naturinteressierten teilen wollen, ist es eine gute Idee, Ihre Sichtungen mit Bildern zu belegen. Diese lassen sich leicht mit einer Digitalkamera oder dem Smartphone anfertigen. Während bei Pilzen, Pflanzen und wenig scheuen Tieren das Smartphone oft ausreicht, sind für die Fotografie von Vögeln oder sehr kleinen Insekten Digitalkameras mit Zoom oder Bridge-Kameras besser geeignet.
Um Details aus der Nähe zu betrachten, sind Botaniker- oder Einschlaglupen ideal. Diese bieten in der Regel eine zehnfache Vergrößerung. Darüber hinaus gibt es Mehrfachlupen, die sich durch Kombinieren verstellen lassen und dadurch sehr flexible Vergrößerungen liefern.
Eine Alternative ist die Becherlupe, bei der eine Lupe fest in den Deckel eines durchsichtigen Behälters eingebaut ist. Ihr Vorteil: Kleine Tiere wie beispielsweise Käfer können nicht einfach wegkrabbeln. Beachten Sie hierbei jedoch unbedingt die gesetzlichen Vorgaben. Das Bundesnaturschutzgesetz verbietet in vielen Fällen sogar das vorübergehende Einfangen von Tieren, was die Nutzungsmöglichkeiten einer Becherlupe erheblich einschränkt.
Zum Beobachten von Unterwasserlebewesen leisten ein dunkler Regenschirm und eine Taschenlampe gute Dienste. Der Regenschirm hilft gegen störende Spiegelungen des Himmels auf der Wasseroberfläche, während die Taschenlampe eine gezielte Beleuchtung der Wasserpflanzen und -tiere ermöglicht.

Durch ein Fernglas betrachtet, fallen die feinen Gefiederdetails des Eisvogels besonders gut auf, Foto © Helene Germer/NABU-naturgucker.de

Larve einer Großlibelle, Foto © Jürgen Gehnen/NABU-naturgucker.de
Naturbeobachtungen melden
Der Emschergenossenschaft und Lippeverband (EGLV) hat die Initiative „Mach mit am Fluss“ ins Leben gerufen, die sich der Natur an der Lippe und der Emscher widmet. Wir von NABU|naturgucker sind Partner dieses Projekts. Ein wichtiger Teil davon ist eine Meldeaktion, bei der Sie Ihre eigenen Naturbeobachtungen von der Lippe (und natürlich auch von der Emscher) ganz einfach per Smartphone über das Portal nabu-naturgucker.de/eglv teilen können. Besonders wertvoll sind dabei Meldungen, die mit Fotos belegt sind.
Alle veröffentlichten Beobachtungsdaten sind öffentlich zugänglich. Dadurch stehen sie sowohl der Forschung als auch dem Naturschutz zur Verfügung. Wenn Sie also an der Lippe unterwegs sind, können Sie sich aktiv an der Erforschung der Artenvielfalt in dieser Region beteiligen.

Arten- und Lebensraumwissen vergrößern
Neben dem Meldeportal für Naturbeobachtungen bietet NABU|naturgucker noch etwas Spannendes an: In der NABU|naturgucker-Akademie* (https://NABU-naturgucker-Akademie.de) finden Sie eine Reihe kostenloser Online-Kurse zu unterschiedlichen naturbezogenen Themen. Die Kurse decken verschiedene Artengruppen ab, von Amphibien und Reptilien über Schmetterlinge, Pflanzen und Pilze bis hin zu Vögeln. Außerdem gibt es Kurse zu bestimmten Lebensräumen, darunter ein spezielles Lernangebot, das sich ausführlich der Natur an Fließgewässern wie der Lippe widmet.
Ergänzt werden diese Kurse durch kostenlose monatliche Online-Vorträge und mehrtägige Exkursionen, die in enger Abstimmung mit der NABU|naturgucker-Akademie geplant werden. Bei diesen kostenpflichtigen Praxistagen, die hauptsächlich in Deutschland stattfinden, lernen die Teilnehmenden von Artenkenner*innen in kleinen Gruppen in der Natur und in Seminaren viel Wissenswertes über die jeweiligen Artengruppen und deren Lebensräume.
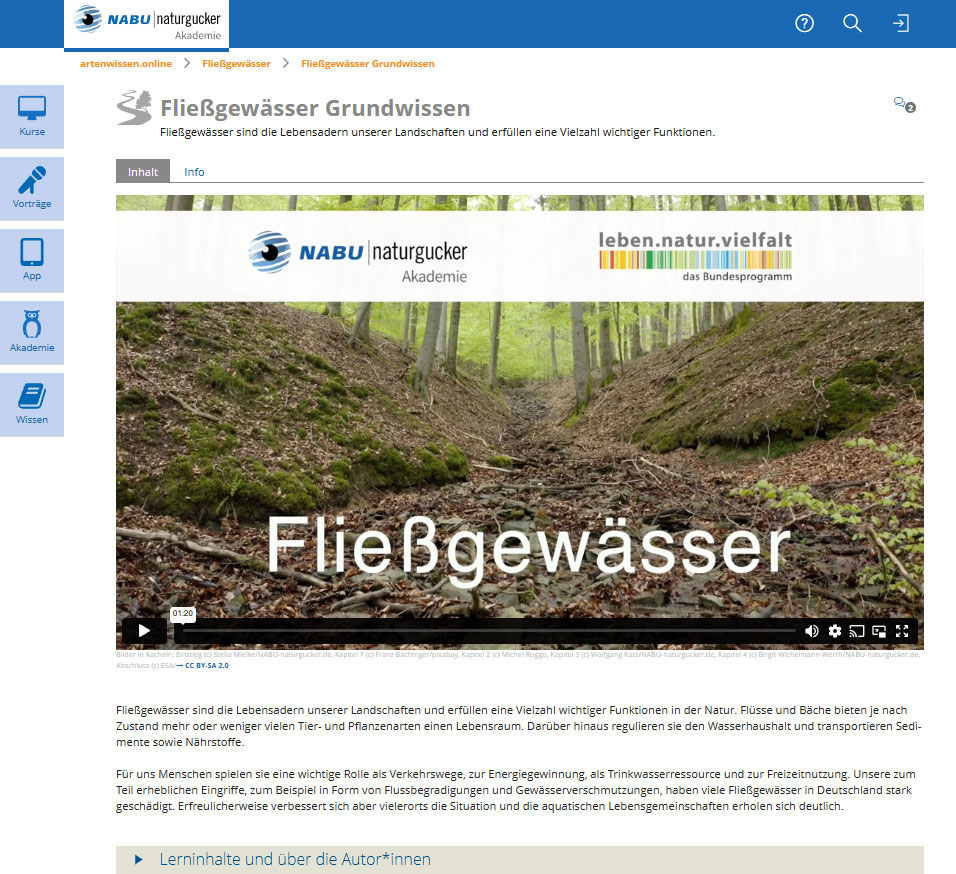
Startseite des Kurses „Fließgewässer Grundwissen“ der NABU|naturgucker-Akademie
Die Natur schonend behandeln
Bei Spaziergängen und Exkursionen, ob an der Lippe oder anderswo, ist ein achtsamer Umgang mit der Natur sehr wichtig. Das bedeutet, sich an die im Bundesnaturschutzgesetz festgelegten Regeln zu halten und insbesondere in Schutzgebieten auf den Wegen zu bleiben und Hunde anzuleinen.
Insbesondere in Uferzonen ist die Natur oft sehr empfindlich, weshalb das Betreten dieser wertvollen und gleichzeitig verletzlichen Lebensräume erheblichen Schaden anrichten kann. Entlang der Lippe gibt es hier und da Bereiche, an denen das Ufer gut begehbar ist, ohne Pflanzen und Tiere zu zertreten. Es empfiehlt sich, nur dort einen näheren Blick auf die kleinen Wasserbewohner zu werfen.

Der Rotfuchs gehört zu den eher scheuen Bewohnern der Lippeauen, Foto © Ulrike Tyroff/NABU-naturgucker.de
Anregungen fürs eigene Beobachten
Was Wasserläufer so treiben …
Von Frühjahr bis Herbst sind auf der Lippe viele Wasserläufer zu beobachten. Diese flinken Insekten halten sich besonders gern in Bereichen mit geringer Strömung auf. Nehmen Sie sich ein wenig Zeit und achten Sie einmal darauf, was passiert, wenn Wasservögel vorbeischwimmen, ein Frosch neben den Wasserläufern ins Wasser springt oder zwei Wasserläufer einander begegnen. Vielleicht fallen Ihnen dabei größere und kleinere Wasserläufer auf, die ein wenig unterschiedlich aussehen. Die größeren sind meist erwachsene Exemplare, die kleineren sind Jungtiere. Bei Wasserläufern und anderen Wanzen werden sie als Nymphen bezeichnet.

Ein Wasserläufer in seinem Element, Foto © Rolf Jantz/NABU-naturgucker.de
Blütenbesucher am Lippeufer
Der Frühling ist die Hochsaison für viele Insektenarten, die sich von Nektar und Pollen ernähren. Doch auch im Sommer gibt es noch zahlreiche sechsbeinige Blütenbesucher. Bleiben Sie doch einmal für fünf oder zehn Minuten vor einer bestimmten Pflanze stehen und beobachten Sie, welche Insekten angeflogen kommen. Sehr wahrscheinlich werden Sie Honigbienen oder Wildbienen sehen. Schwebfliegen und Schmetterlinge gehören ebenfalls zu den Insekten, die mit ihren kleinen Flügeln zu den „Nektar-Tankstellen“ reisen. Darüber hinaus mögen einige Käferarten Nektar und Pollen, andere fressen lieber an den Blättern der Pflanzen. Haben Sie eine Weile lang hingeschaut, suchen Sie sich eine andere Pflanzenart und machen dort dasselbe. Mit etwas Glück fallen Ihnen dann weitere Insektenarten auf, denn viele dieser kleinen Tiere haben eine Vorliebe für bestimmte Blüten oder Blätter. So gewinnen Sie einen Eindruck von der Insektenvielfalt der Lippeauen und -ufer.

Der Kleine Fuchs ist eine der entlang der Lippe lebenden Schmetterlingsarten, Foto © Klaus Ashoff/NABU-naturgucker.de
* Das Projekt NABU|naturgucker-Akademie wird von Dezember 2020 bis Dezember 2026 gefördert im Bundesprogramm Biologische Vielfalt durch das Bundesamt für Naturschutz mit Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit.
Neue Schule Dorsten
Tiere an Gewässern
Liebe Leserinnen und Leser,
ich freue mich Ihnen ein besonderes Projekt vorstellen zu dürfen, das die Schülerinnen und Schüler der Klasse 8b der Neuen Schule Dorsten im Biologieunterricht durchgeführt haben. Gemeinsam mit meiner Klasse haben wir uns auf eine spannende Entdeckungsreise entlang der Lippe begeben – einem Fluss, der nicht nur unsere Region prägt, sondern auch Lebensraum für viele faszinierende Tierarten ist.
Unter dem Motto „Tiere an der Lippe – entdecken, verstehen, schützen“ haben die Schülerinnen und Schüler recherchiert, beobachtet, geschrieben und gestaltet. Entstanden sind dabei beeindruckende Steckbriefe, Infotexte und kreative Fabeln über Tiere, die in, an und um die Lippe leben.
Besonders stolz bin ich darauf, mit wie viel Engagement, Neugier und Verantwortungsbewusstsein die Schülerinnen und Schüler sich mit dem Thema Artenschutz auseinandergesetzt haben.
Die Ausarbeitungen zeigen eindrucksvoll, dass Naturschutz nicht irgendwo weit weg passiert, sondern direkt vor unserer Haustür beginnt. Mit jedem Tier, das die Schülerinnen und Schüler beschrieben haben, haben sie dazu beigetragen, seine Bedeutung für unser Ökosystem sichtbar zu machen – und regen hoffentlich viele Menschen zum Nachdenken an.
Ein ganz herzliches Dankeschön geht an alle, die dieses Projekt unterstützt haben. Mein besonderer Dank gilt aber euch, liebe Schülerinnen und Schüler: Ihr habt gezeigt, wie viel man bewirken kann, wenn man sich mit Herz und Verstand einer Sache widmet.
Ich hoffe, dass dieses Projekt nicht nur Wissen vermittelt, sondern auch den Wunsch, unsere heimische Natur weiterhin zu schützen und zu bewahren.
Viel Spaß beim Entdecken!
Sarah Hölter (Lehrerin der Neuen Schule Dorsten)
INSEKTEN
Die Hummel
Steckbrief
Größe: Männliche Dunkle Erdhummeln kann bis zu eine Körperlänge von bis zu 17 Millimetern, die Arbeiterinnen werden bis zu 16 Millimeter lang und die Königinnen bis zu 23 Millimetern.

|
Nahrung: Pollen & Nektar
Arbeitszeit: 18 Stunden am Tag
Lieblingsblütenfarbe: Sie sind am liebsten auf den lilafarbene und blaue Blüten.
Alter: Die Königin kann nur bis zu 1 Jahr alt werden, die anderen Hummeln leben nur bis zu 3-4 Wochen .
Jahreszeiten des Lebensraum : April bis Oktober
Lebensraum: Sie leben unterirdisch in den verlassenen Mäusenestern oder über der erde in Hohlräumen oder unter den Grasbüschel.
Der Hummel Flug: Höchstgeschwindigkeit sind ca.20km/h bis zu 90 Metern pro Stunde.
J.H.
Die Biene – Ein kleines Tier mit großer Bedeutung
Bienen sind kleine Insekten, die auf der ganzen Welt bekannt sind. Viele Menschen denken bei Bienen sofort an Honig, aber sie können noch viel mehr. Sie spielen eine sehr wichtige Rolle in der Natur, vor allem bei der Bestäubung von Pflanzen.
Bienen gehören zur Familie der Insekten und leben meist in einem Bienenstock. Dort gibt es eine Königin, viele Arbeiterinnen und einige Drohnen. Die Königin ist dafür zuständig, Eier zu legen, während die Arbeiterinnen den Stock sauber halten, Nektar sammeln und sich um die Larven kümmern. Die Drohnen haben die Aufgabe, die Königin zu befruchten.
Eine der wichtigsten Aufgaben der Bienen ist die Bestäubung. Wenn sie von Blume zu Blume fliegen, bleibt Pollen an ihrem Körper hängen und wird zur nächsten Blüte gebracht. Dadurch können Pflanzen Früchte und Samen bilden. Ohne Bienen gäbe es also viel weniger Obst und Gemüse. Deshalb sind Bienen für die Landwirtschaft sehr wichtig.
Leider sind Bienen heute in Gefahr. Pestizide, Klimawandel und der Verlust von Lebensraum machen ihnen das Leben schwer. Wenn wir nichts dagegen tun, könnten viele Bienenarten aussterben. Das hätte große Folgen für die Natur und auch für uns Menschen.
Darum ist es wichtig, dass wir Bienen schützen. Jeder kann etwas tun: zum Beispiel bienenfreundliche Blumen pflanzen, keine giftigen Sprays im Garten benutzen oder Honig aus der Region kaufen.
Fazit:
Bienen sind nicht nur wichtig, weil sie Honig machen, sondern weil sie die Natur im Gleichgewicht halten. Ohne sie würde unsere Welt ganz anders aussehen. Deshalb sollten wir alles tun, um sie zu retten

https://tse3.mm.bing.net/th/id/OIP.oMDyuAVrkgebwHoJPA6zdQHaD-?rs=1&pid=ImgDetMain&o=7&rm=3
Die Hornisse

|
Verbreitung & Lebensraum
- Kommt in fast ganz Europa vor; bevorzugt gemäßigte Regionen.
- Lebensräume sind Wälder, Waldränder, Parks, Obstgärten und auch menschliche Siedlungen, wenn geeignete Nestplätze vorhanden sind.
- Nistplätze: Baumhöhlen, hohle Baumstämme, alte Bauten; auch künstliche Hohlräume wie Dachböden, Rollladenkästen oder Vogelkasten.
Lebenszyklus & Verhalten
- Nestgründung: Anfang Mai beginnt eine befruchtete Jungkönigin mit dem Nestbau.
- Entwicklung: Zuerst legt sie Eier, aus denen die ersten Arbeiterinnen schlüpfen. Diese übernehmen dann Brutpflege, Nestausbau und Futtersuche.
- Volkgröße: Je nach Zeitraum und Bedingungen kann ein Volk mehrere hundert Arbeiterinnen umfassen, häufig zwischen 200‑800 Tieren in Mitteleuropa.
- Nahrung: Pflanzensäfte, Nektar, Honigtau, Fallobst usw. Also süßere Nahrungsquellen.
Bedeutung & Schutz
- Ökologische Rolle: Hornissen sind wichtige Räuber von vielen Insekten, die als Schädlinge gelten können. Sie helfen dabei, das ökologische Gleichgewicht zu halten. Umweltbundesamt
- Gefährdung: Durch Lebensraumverlust, fehlende Nistplätze und intensive Nutzung von Flächen. Auch durch Verwechslung mit invasiven Hornissenarten.
- Rechtlicher Schutz: In vielen Regionen unterliegt die Europäische Hornisse Schutz. Sie darf nicht ohne Grund getötet oder ihr Nest zerstört werden.
Die Ameise – Ein spannendes Insekt
Die Ameise gehört zur Familie der Formicidae und ist ein kleines, aber sehr interessantes Insekt, das fast überall auf der Welt lebt. Es gibt ungefähr 12.000 verschiedene Ameisenarten, die man in verschiedenen Umgebungen finden kann – zum Beispiel im Wald, in der Wüste oder sogar in Städten (Quelle: Spektrum der Wissenschaft, 2023).
Wie sieht eine Ameise aus?
Eine Ameise hat einen Körper, der aus drei Teilen besteht: Kopf, Brust (Thorax) und Hinterleib (Abdomen). Sie hat sechs Beine und zwei Fühler, mit denen sie ihre Umwelt erspürt. Ihre Kiefer, die man Mandibeln nennt, sind sehr stark und helfen ihr, Nahrung zu zerkleinern oder das Nest zu bauen (Quelle: National Geographic, 2022).
Wie leben Ameisen?
Ameisen leben in großen Gruppen, die man Kolonien nennt. In so einer Kolonie gibt es meist eine oder mehrere Königinnen, die Eier legen, viele Arbeiterinnen, die Nahrung sammeln und das Nest pflegen, und männliche Ameisen, deren Aufgabe es ist, die Königin zu befruchten (Quelle: Brockhaus Natur, 2021). Ameisen sind soziale Tiere und arbeiten zusammen, fast wie ein großes Team.
Wie kommunizieren Ameisen?
Ameisen reden nicht mit Worten, sondern mit Gerüchen. Sie hinterlassen Pheromone, also spezielle Duftstoffe, um anderen Ameisen zu zeigen, wo es Essen gibt oder um Alarm zu schlagen, wenn Gefahr droht (Quelle: Spektrum der Wissenschaft, 2023).
Was fressen Ameisen?
Die meisten Ameisen fressen alles Mögliche, zum Beispiel kleine Tiere, Pflanzen oder süße Flüssigkeiten wie Honigtau, den sie von Blattläusen bekommen. Einige Ameisenarten züchten sogar Pilze oder halten Blattläuse, um von deren süßen Ausscheidungen zu profitieren (Quelle: National Geographic, 2022).
Warum sind Ameisen wichtig?
Ameisen sind wichtig für die Natur, weil sie helfen, den Boden zu lockern, Pflanzenreste abzubauen und Samen zu verbreiten. So sorgen sie dafür, dass das Ökosystem gesund bleibt. Manchmal können sie aber auch als Schädlinge auftreten, wenn sie in Häuser eindringen oder Pflanzen schaden (Quelle: Brockhaus Natur, 2021).
Besondere Fähigkeiten
Ameisen sind unglaublich stark für ihre Größe – sie können das 10- bis 50-fache ihres eigenen Gewichts tragen. Außerdem sind sie sehr organisiert und arbeiten gut im Team, was sie zu sehr erfolgreichen Insekten macht (Quelle: Spektrum der Wissenschaft, 2023).
Mio Gries
VÖGEL
Die Zwerggans
- Wissenschaftlicher Name: Anser erythropus
- Größe: 55–70 cm (kleiner als normale Gänse)
- Gewicht: 1,5–2,5 kg
- Lebensraum:
- Kommt aus dem Norden (z. B. Sibirien und Skandinavien)
- Im Winter fliegen sie in wärmere Gegenden, z. B. Südeuropa oder Westafrika
- Ernährung:
- Frisst Gräser, Kräuter und Beeren
- Auch Wurzeln und Samen gehören zu ihrer Nahrung
- Fortpflanzung:
- Sie brüten von April bis Juni
- Das Nest bauen sie auf dem Boden
- Ein Gelege hat etwa 4–6 Eier, die sie 25–28 Tage lang bebrüten
- Besonderes:
- Sie ist kleiner als andere Gänse und hat einen kurzen Hals
- Das Gefieder ist braun mit weißen Flecken an Kopf und Hals
- Sie ist in Europa ziemlich selten und gilt als gefährdet

|
Jessica L.
Kolkraben
Der Kolkrabe an der Lippe – Ein majestätischer Vogel in unserer Region
Lebensraum an der Lippe

Bild Quelle: Wikipedia.de
Lebensraum an der Lippe
Die Lippe und ihre umliegenden Auen, Wälder und offenen Landschaften bieten dem Kolkraben ideale Bedingungen. Besonders in naturnahen Abschnitten des Flusses, wo alte Bäume und ruhige Bereiche zu finden sind, kann er brüten oder rasten. Kolkraben bevorzugen strukturreiche Lebensräume, in denen sie sowohl Nahrung finden als auch Horste bauen können.
Merkmale des Kolkraben
Kolkraben sind mit einer Spannweite von bis zu 1,30 Metern beeindruckend groß. Ihr Gefieder ist tiefschwarz mit einem metallischen Glanz. Sie haben einen kräftigen und einen leicht gebogenen Schnabel.
Verhalten und Ernährung
Kolkraben sind Allesfresser. Sie ernähren sich unter anderem von Aas, Insekten, kleinen Wirbeltieren, Eiern, Beeren und sogar Abfällen. Ihre hohe Intelligenz erlaubt es ihnen, komplexe Probleme zu lösen – etwa Nüsse auf Straßen fallen zu lassen, damit Autos sie knacken.
In der Umgebung der Lippe profitieren sie auch von extensiver Landwirtschaft und naturnahen Flächen, die ein reiches Nahrungsangebot bieten.
Schutzstatus
Der Kolkrabe war in Deutschland lange Zeit selten, da er verfolgt wurde. Dank strenger Schutzmaßnahmen hat sich sein Bestand erholt. Heute ist er wieder in vielen Regionen Nordrhein-Westfalens heimisch, auch entlang der Lippe.
Fazit
Der Kolkrabe ist ein faszinierender Vogel, der auch an der Lippe wieder häufiger zu beobachten ist. Wer mit offenen Augen und Ohren entlang des Flusses unterwegs ist, hat vielleicht das Glück, diesen klugen und eindrucksvollen Vogel zu entdecken – sei es beim Flug über den Fluss, beim Rufen aus einem Baum oder beim Suchen nach Futter.
Yahia Al-Salih
Schwäne – Elegante Vögel an der Lippe

|
Schwäne gehören zu den auffälligsten und elegantesten Wasservögeln, die man an Flüssen, Seen und Teichen beobachten kann – auch an der Lippe. Besonders bekannt ist der Höckerschwan, der durch sein weißes Gefieder und den orangefarbenen Schnabel mit schwarzem Höcker auffällt. Es gibt aber auch andere Schwanenarten, wie den Singschwan oder den seltenen Zwergschwan.
Schwäne sind große Vögel: Ein erwachsener Höckerschwan kann bis zu 14 Kilogramm wiegen und eine Flügelspannweite von über zwei Metern haben. Trotz ihrer Größe wirken sie im Wasser oft leicht und anmutig, was sie zu einem beliebten Motiv in der Kunst macht.
Diese Tiere leben meist in festen Paaren, oft ein Leben lang. Das hat ihnen auch den Ruf eingebracht, ein Symbol für Treue und Liebe zu sein. Sie bauen ihre Nester an Ufern oder in Schilfzonen, wo sie gut versteckt sind. Ein Schwanenpaar legt meistens zwischen 5 und 7 Eier, aus denen nach etwa einem Monat die Küken schlüpfen.
Auch wenn sie friedlich aussehen, können Schwäne ziemlich wehrhaft sein. Vor allem in der Brutzeit verteidigen sie ihr Revier mit kräftigem Flügelschlagen und lautem Zischen. Deshalb sollte man ihnen in der Natur mit Respekt begegnen und Abstand halten.
An der Lippe kann man Schwäne mit etwas Glück in ruhigen Uferzonen beobachten, oft zusammen mit anderen Wasservögeln wie Enten oder Blesshühnern. Sie sind nicht nur ein schöner Anblick, sondern auch ein wichtiger Teil des Ökosystems: Sie fressen Wasserpflanzen und halten so das Gleichgewicht im Gewässer mit aufrecht.
Für mein Projekt habe ich den Schwan ausgewählt, weil er Stärke, Schönheit und Ruhe ausstrahlt –genau wie die Lippe an manchen Tagen wirkt.
Ahmad M.
Eisvogel

Bild: Nabu.de
Steckbrief:
Name: Eisvogel (Wissenschaftlichername:Alcedo atthis)
Lebensraum: An der Lippe, vor allem in Flussnähe, wo es klares Wasser gibt.
Aussehen: Der Eisvogel ist klein, etwa 16-17 cm lang. Er hat ein leuchtend blauen Rücken und Flügel, einen orangefarbenen Bauch und einen langen, spitzen Schnabel. Sein Kopf ist ebenfalls blau, mit einem kleinen weißen Fleck an der Kehle.
Ernährung: Er frisst hauptsächlich kleine Fische, die er im Wasser jagt. Man sieht ihn oft, wie er blitzschnell ins Wasser taucht.
Verhalten: Der Eisvogel ist ein sehr geschickter Jäger. Er sitzt oft auf einem Ast und wartet, bis ein Fisch vorbei schwimmt, dann taucht er ins Wasser.
Besonderheiten: Der Eisvogel ist ein Symbol für Reinheit und Glück. Er ist in Deutschland geschützt, weil sein Lebensraum durch Umweltverschmutzung bedroht ist.
Interessantes: Der Eisvogel baut seine Nester in hohlen Baumstämmen oder Erdlöchern in Ufernähe.
Romilda V.
Die Stockente
Die Stockenten an der Lippe in Dorsten
Wie sehen sie aus und wie lassen sie sich unterscheiden?
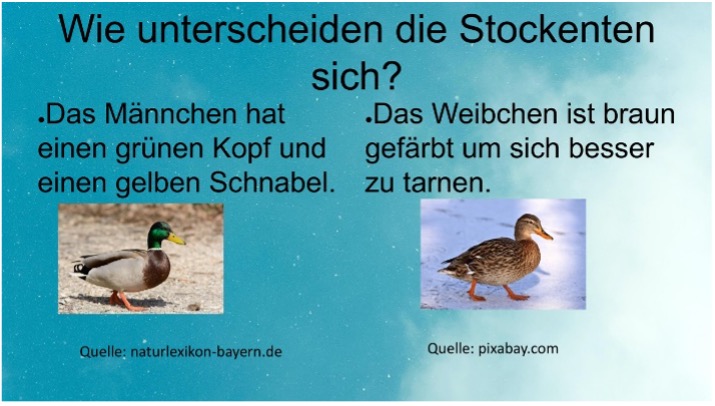
Wo leben sie? Sie leben an Flüssen, Seen und Teichen.
Wovon ernähren sich die Stockenten? Stockenten ernähren sich von Wasserpflanzen Insekten und kleinen Fischen, aber Brot ist ungesund für sie.
In welchem Monat legen sie Eier, wieviele und wann schlüpfen sie? Das Weibchen legt im Frühling bis zu 14 Eier. Aus den Eiern werden nach etwa 28 Tagen die Küken schlüpfen.
Was tragen Stockenten zu der Natur bei? Stockenten sind wichtig für die Natur, weil sie Pflanzen verbreiten und Teil der Nahrungskette sind.
Justin Konopka
FISCHE
Der Hecht

|
Ich hab mich mit einem besonderen Fisch beschäftigt, dem Hecht…
Fischname: Hecht
Gewicht : 0,5-1,4
Lebenserwartung : 10-15 Jahre
Lebensraum : Loch Ness , Bodensee , Comer See , Zürichsee , Mjosa , Gardasee , Oberer See , Langensee … und natürlich auch der Lippe …
Wissenschaftlicher Name :Exo lucius
Familie : Esocaide
Geschwindigkeit : 12-16 km
Ernährung : Fische , Frösche , kleine Wasservögel , Mäuse
Besonderheit : langgestreckter , seitlich nur wenig , zusammengedrückter Körper
Gewicht 29kg , Gesamtlänge 1,47 m und Umfang 80cm
Feind : Kormorane , Fischreiher , Seeadler
L.W.
Der Barsch
Barsche sind eine weit verbreitete Fischart in vielen Süßgewässern, besonders in Europa und Nordamerika. Sie gehören zur Familie der Percidae und sind für ihre markanten, dunklen Streifen auf einem grünlichen bis olivfarbenen Körper bekannt. Die Streifen verlaufen meist quer über ihren Körper und machen sie leicht erkennbar. Barsche sind Raubfische und jagen hauptsächlich kleinere Fische und Wasserinsekten. Sie sind auch für ihre Jagdtechnik bekannt: Sie bewegen sich oft in Gruppen, um ihre Beute effizienter zu fangen.
In der Regel werden Barsche nicht sehr groß – die meisten bleiben unter 40 cm, aber in Ausnahmefällen können sie auch bis zu 50 cm lang werden. Ihr Gewicht variiert je nach Größe und Lebensraum, aber die durchschnittlichen Barsche wiegen etwa 1–2 Kilogramm. Diese Fische sind auch bei Anglern sehr beliebt. Ihre Schnelligkeit und Aggressivität machen sie zu einer echten Herausforderung beim Angeln. Besonders im Frühling, wenn sie in wärmeres Wasser ziehen, werden Barsche gerne geangelt.
Die Lebensräume von Barschen sind in der Regel Seen, Flüsse und Teiche mit klarem Wasser und vielen Pflanzen. Barsche bevorzugen Orte, an denen sie viele Versteckmöglichkeiten und eine gute Aussicht auf ihre Beute haben. Sie können sowohl in flachem als auch in tieferem Wasser leben, sind aber vor allem in Bereichen mit einer Wassertiefe von 1 bis 5 Metern zu finden. In großen Gewässern bilden sie oft Schwärme, die sich je nach Jahreszeit oder Nahrungsangebot verändern können.
Im Winter ziehen Barsche oft in tiefere Gewässer, da die Temperaturen in den oberen Schichten sinken. In dieser Zeit sind sie weniger aktiv und suchen nach wärmeren, ruhigeren Bereichen. Aber im Frühling, wenn die Wassertemperaturen steigen, werden Barsche wieder aktiver und suchen nach Nahrungsquellen. Dies ist auch die Zeit, in der sie sich fortpflanzen. Männliche Barsche beginnen, in flachen Bereichen des Gewässers Nester zu bauen, in die die Weibchen ihre Eier ablegen. Nach der Eiablage bewachen die Männchen das Nest und beschützen die Eier vor anderen Fischen und Raubtieren.

Google:https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://pro-fishing.de/blog/barsch-alle-informationen-zum-fisch/&ved=2ahUKEwj2-v7GldCPAxX-1gIHHUHAAHkQ2LwJegQIFxAB&usg=AOvVaw31q7s4EZb9ZDpaYGHscBGK
Kerem S.
SÄUGETIERE
Feldmäuse
Feldmäuse gehören zu den bekanntesten Nagetieren in Europa. Man sieht sie zwar selten, aber sie sind fast überall auf Wiesen, Feldern oder an Waldrändern unterwegs. Sie sind ziemlich klein, meistens nur so 10 cm lang, und ihr Fell ist meistens braun oder grau, damit sie sich gut tarnen können, an ihrem Bauch sind die aber meistens hell.
Feldmäuse leben in unterirdischen Gängen, die sie selbst graben. Dort verstecken sie sich vor Feinden wie Füchsen, Eulen oder Katzen. In ihren Bauen lagern sie auch Futter oder bekommen dort ihre Jungen. Eine Feldmaus kann mehrmals im Jahr Nachwuchs bekommen, meistens 4–6 Babys auf einmal. Deshalb gibt es manchmal sehr viele von ihnen, was für Bauern ein Problem sein kann, weil die Mäuse viele Pflanzen auf den Feldern anknabbern.
Sie ernähren sich hauptsächlich von Gräsern, Samen, Wurzeln und manchmal auch Insekten. Im Herbst sammeln sie Vorräte für den Winter, denn sie halten keinen richtigen Winterschlaf, sondern werden nur ein bisschen weniger aktiv.
Auch wenn Feldmäuse für die Landwirtschaft oft nervig sind, sind sie super wichtig für das Ökosystem. Viele Tiere ernähren sich von ihnen, und ohne sie würde das Gleichgewicht in der Natur gestört werden.
Ich finde es spannend, wie so ein kleines Tier so einen großen Einfluss auf die Umwelt haben kann!

Lilly R.
Der Fischotter
Der Regen nieselte sanft auf die Lippe, der Himmel war ganz grau geworden und eine kleine Silhouette huschte unbemerkt
über das hoch gewachsene Gras hinweg.
Der kleine Schatten lief hektisch in Richtung des Ufers und kletterte in den Tunnel, der in das Ufer hinein führte.
Das schlanke Raubtier lies den Frosch aus seinem
Maul fallen, sein dichtes braunes Fell war noch ganz nass nach der langen Jagd.
Sein Kopf rundlich, kleine Ohren, einen stromlinienförmigen Körper, das leicht zerzauste braune Fell schien heller an der Bauchseite und er stapfte auf das weiche Moos im Bau, zwischen den Zehen waren Schwimmhäute und immer wieder klopfte der kleine Marder mit seinem kräftigen Schwanz auf das Moos.
Zufrieden betrachtet der junge Fischotter seine erlegte Beute obwohl dieser lieber Fische oder Wasservögel fraß war er recht stolz auf sein heutiges fressen.
Die Stille wurde durchbrochen als ein weiblicher Fischotter durch den Bau trat und sich an den anderen Fischotter schmiegte, sie ließ ebenfalls ihre bereits tote Beute vor dem anderen Otter fallen. Die erlegte Beute war eine Maus.
Beide stolz auf sich da sie ihre Mission des Tages erfüllt hatten und zwar die ausgewogene Population an der Lippe zu halten.
Joella T.
Bündnis Artenvielfalt NRW: Forderungen
Wir erleben einen dramatischen Verlust an Tier- und Pflanzenarten. Vor allem der Rückgang von Insekten und Vögeln führt deutlich vor Augen, dass wir in vielen Handlungs- und Politikfeldern grundlegend umsteuern müssen. Besonders dramatisch ist hierbei, dass diese Verluste ebenfalls und ungebremst Schutzgebiete betreffen – und damit die letzten Rückzugsräume für eine große Vielzahl von Arten.
Notwendig ist ein breites Bündel an Maßnahmen, das weit über die Notwendigkeiten hinausreicht, die das Landesnaturschutzrecht fordert. Ob Landesplanung, Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Bauen, Wirtschaft oder Verkehr: Die Verantwortlichkeiten für einen ambitionierten Artenschutz in Nordrhein-Westfalen sind über verschiedene Landesministerien verteilt. Alle müssen sich ihrer Verantwortung für diese gesellschaftliche Aufgabe stellen und handeln.
Nachfolgend skizzieren wir 8 Handlungsfelder für den Erhalt und die Förderung der Artenvielfalt in Nordrhein-Westfalen. Ziel der Volksinitiative ist es, die geforderten Maßnahmen umzusetzen und verbindlich in die Landesgesetze und die entsprechenden Programme aufzunehmen.
1. Flächenfraß verbindlich stoppen
2. Schutzgebiete wirksam schützen
3. Naturnahe und wilde Wälder zulassen
4. Naturverträgliche Landwirtschaft aktiv voranbringen
5. Biotopverbund stärken und ausweiten
6. Lebendige Gewässer und Auen sichern
7. Artenschutz in der Stadt fördern
8. Nationalpark in der Senne ausweisen
1
Flächenfraß verbindlich stoppen
Täglich gehen in Nordrhein-Westfalen rund zehn Hektar Fläche durch neue Wohn- und Gewerbegebiete, Straßenbau, Tagebau, Kies-Abbau und andere Abgrabungen unwiederbringlich verloren. Landschaften werden zerschnitten, angrenzende Lebensräume gestört. Eine Fortsetzung dieses unverantwortlichen Handelns führt unweigerlich zu zusätzlichen irreversiblen Verlusten bei Tier- und Pflanzenarten. Vor allem landwirtschaftliche Flächen gehen ungebremst verloren. Die Pachtpreise steigen stetig an, erschweren eine aus Naturschutzsicht vielerorts gebotene Extensivierung und drücken weitere bäuerliche Betriebe ins wirtschaftliche Aus.
Wir fordern eine neue Landesentwicklungsplanung mit Regelungen und Instrumenten, die verbindlich den Flächenverbrauch im Land bis 2025 auf maximal 5 Hektar pro Tag und bis 2035 ganz auf Null absenken. Nachverdichtung, Erschließung von Industriebrachen (Flächenrecycling), Umnutzungen und Aufstockungen von Wohn- und Gewerbegebäuden müssen gegenüber einer Neuversiegelung deutlich attraktiver werden und Vorrang haben. Das Land hat ein Instrument zu schaffen, das transparent und nachvollziehbar dar- und sicherstellt, dass mit dem Erreichen der genannten Obergrenzen verbindlich keine Neuversiegelung im laufenden Jahr mehr erfolgt.
2
Schutzgebiete wirksam schützen
Naturschutz- und FFH-Gebiete, geschützte Landschaftsbestandteile und gesetzlich geschützte Biotope haben eine herausragende Aufgabe: Sie sollen Lebensräume und ihre Artenvielfalt bewahren und fördern. Trotzdem ist es immer noch zulässig, dass auf Flächen innerhalb von Schutzgebieten Pestizide eingesetzt werden, die dort lebende Insekten und andere Tiere sowie die dort vorkommenden Pflanzen schädigen können. Das muss sich ändern!
Wir fordern ein umfassendes Verbot von chemisch-synthetischen Pestiziden und leichtlöslichen Mineraldüngern in Schutzgebieten. Des Weiteren sollen wirksame Pufferzonen um besonders schützenswerte Flächen mit einer klaren Reduktionsstrategie für Pestizide und Düngemittel eingerichtet werden. Neben schon bestehenden Schutzgebieten sind weitere wichtige Lebensräume, Naturflächen und Arten oder Lebensgemeinschaften dauerhaft zu sichern. In der Umsetzung muss sichergestellt werden, dass Biolandwirten und dem Vertragsnaturschutz hierdurch keine Nachteile entstehen.
3
Naturnahe und wilde Wälder zulassen
Wälder sind unverzichtbare Lebensräume mit eigener Dynamik und einem enormen Inventar an Pflanzen- und Tierarten. Auch als „grüne Lunge” übernehmen sie in Zeiten des Klimawandels wichtige Funktionen für das Allgemeinwohl. Doch 25% der Arten des Waldes sind in Nordrhein-Westfalen bereits gefährdet oder ausgestorben. Wesentliche Ursache für die Gefährdung von geschützten Waldökosystemen in Deutschland ist das bisherige forstliche Management.
Wir fordern, dass das Land Nordrhein-Westfalen in seinen Staatswäldern Vorreiter für eine natürliche Waldentwicklung und Artenvielfalt wird. Dazu müssen kurzfristig mindestens 20% dieser Flächen aus der forstlichen Nutzung genommen werden. Darüber hinaus sollen bis zum Jahr 2030 10% der Gesamtwaldfläche des Landes auch nach Möglichkeit außerhalb des Staatswaldes aus der Nutzung genommen und der Weg dahin durch geeignete Landesprogramme für private und kommunale Waldbesitzer gefördert werden.
Des Weiteren fordern wir, Naturverjüngung statt flächiger Aufforstungen und nur im Bedarfsfall truppweise Anpflanzung standortheimischer Arten und Sorten, den Verzicht auf Pestizide und Kalkungen sowie die Wiedervernässung von Sumpf- und Moorstandorten im Wald und den vollständigen Erhalt von Alt- und Totholz.
4
Naturverträgliche Landwirtschaft aktiv voranbringen
Fast die Hälfte der Landesfläche wird landwirtschaftlich genutzt. Über Jahrzehnte hinweg kam es hier zum Verlust von Landschaftsstrukturen und vielfältigen Standortbedingungen. Starke Düngung verdrängt zahlreiche Pflanzenarten auf nährstoffarmen Böden, Insekten und Vögeln fehlen oft Nahrung und Lebensräume. Hinzu kommt großflächig der Einsatz von Pestiziden. Gleichzeitig zeigen sowohl der Ökolandbau wie auch engagierte konventionelle Bäuerinnen und Bauern in ihrer täglichen Arbeit, dass es auch anders geht.
Wir fordern, dass das Land Nordrhein-Westfalen auf den eigenen Flächen Vorreiter für den Erhalt der Artenvielfalt wird. Dazu müssen schnellstmöglich alle Grünland- und Ackerflächen im Eigentum des Landes nach den Grundsätzen des ökologischen Landbaus bewirtschaftet werden. Die vom Land betriebenen oder verpachteten Einrichtungen der Gemeinschaftsverpflegung (Kantinen etc.) sollen verbindlich und vorrangig Erzeugnisse aus regionalem ökologischen Anbau und regionaler extensiver Weidehaltung beziehen. Dadurch soll auch die von Bauern geforderte stärkere Nachfrage nach umwelt- und tierschutzgerecht erzeugten Lebensmitteln dauerhaft gesteigert werden. Förderprogramme des Landes für Kommunen bei der Gemeinschaftsverpflegung sollen diese ebenfalls als Fördervoraussetzung festschreiben. Insgesamt sollen in Nordrhein-Westfalen bis 2030 25% der Anbauflächen ökologisch bewirtschaftet werden.
5
Biotopverbund stärken und ausweiten
Gewässerränder, artenreiche Säume, Wiesen, Weiden, Hecken und weitere Strukturen sind unverzichtbar für die Ausbreitung und Wanderung von Arten und den genetischen Austausch. Sie müssen erhalten, zurückgewonnen und gefördert werden.
Wir fordern, dass das Land Nordrhein-Westfalen ein Netz miteinander verbundener Biotope (Biotopverbund) festsetzt, das bis zum Jahr 2025 mindestens 20% der Landesfläche umfasst. Ein deutlicher Schwerpunkt soll im Offenland liegen.
6
Lebendige Gewässer und Auen sichern
Bäche, Flüsse und ihre Auen sind als Lebensräume und Wanderkorridore mit ihrer artenreichen und bedeutenden Pflanzen- und Tierwelt besonders schützenswert. Der ökologische Zustand vieler Gewässer ist besorgniserregend. Umfassende Richtlinien zur Verbesserung der Situation werden bisher nicht vollständig umgesetzt und konnten daher diese negativen Entwicklungen nicht umkehren.
Wir fordern, dass Gewässer und Auen besser geschützt und renaturiert werden. Zum Schutz von Flora und Fauna entlang von Gewässern sind bei Grünland und ackerbaulicher Nutzung Randstreifen verbindlich einzuhalten, in denen chemisch-synthetische Pestizide sowie mineralische Dünger und Gülle nicht ausgebracht werden dürfen.
7
Artenschutz in der Stadt fördern
Auch unsere Städte sind wichtiger Lebensraum für die Tier- und Pflanzenwelt. Doch die zunehmende Versiegelung, die künstliche Dauer-Beleuchtung und eine vielen Tierarten abträgliche Architektur greifen immer stärker in die Lebensgemeinschaften ein. Die Lichtverschmutzung führt zu einem erheblichen Rückgang bei Insekten, Millionen Vögel sterben jährlich durch Kollision an Glasfassaden, Mauersegler und Co. finden keine geeigneten Brutplätze mehr. Dabei gilt es, unsere Städte generell grüner und damit lebenswerter zu machen: Nicht nur für mehr Artenvielfalt, sondern auch, um die gravierenden Folgen des menschgemachten Klimawandels abzumildern.
Wir fordern, dass auf Landesebene geeignete Regelungen getroffen werden, die Lichtverschmutzung verbindlich einzudämmen. Über die Landesbauordnung müssen klare Vorgaben zur Vermeidung von Vogelschlag an Glas- und anderen Fassaden verankert werden. Beim Bau neuer Gebäude sind ausreichend Vorkehrungen zu treffen, damit Gebäude-brütende Vogelarten ausreichend Nistmöglichkeiten erhalten. Das Land muss dabei eine Vorreiterrolle übernehmen und die Artenvielfalt an allen eigenen Liegenschaften fördern, zum Beispiel durch Fassaden- und Dachbegrünung sowie Nistkästen. Zudem muss eine Pflicht zur Verabschiedung kommunaler Baumschutzsatzungen ins Landesnaturschutzgesetz aufgenommen sowie ein verbindlicher Ausschluss sogenannter Schottergärten in der Landesbauordnung verankert werden.
8
Nationalpark in der Senne ausweisen
Der Truppenübungsplatz Senne gehört zu den artenreichsten Naturgebieten in Nordrhein-Westfalen. Offene Heideflächen, Sandmagerrasen, Moore, Auen- und Kiefernwälder sowie naturnahe Bäche auf einer Fläche von über 10.000 Hektar prägen das Gebiet mit seiner europaweit herausragenden Fauna und Flora. Zahlreiche besonders gefährdete Arten haben hier ihre letzten Vorkommen in NRW oder in Deutschland. 1991 beschloss der Landtag einstimmig, nach Beendigung der militärischen Nutzung einen Nationalpark Senne einzurichten. 2016 hat die Landesregierung dieses Ziel im Landesentwicklungsplan festgeschrieben, im Jahr 2019 jedoch wieder gestrichen.
Wir fordern, diesen unverantwortlichen Rückschritt im Landesentwicklungsplan zu korrigieren und aktiv darauf hinzuwirken, diesen Hotspot der Biodiversität in NRW dauerhaft für Naturschutz und Artenvielfalt zu sichern.
Quelle: https://artenvielfalt-nrw.de/forderungen/
Klaus-Dieter Krause
Was Kröte, Molch und Frosch sich erzählen
Wir sind Kunigunde, Manni und Felix. Wir drei möchten Euch jetzt etwas über ein wichtiges Thema erzählen. Es geht um Amphienschutz. Und davon verstehen wir was. Denn wir sind Kunigunde Kröte, Manni Molch und Felix Frosch.
Kunigunde: Ich fang mal an. Im goldenen Zeitalter, als sich die Zweibeiner hierzulande noch nicht ausgebreitet hatten, lebten in den Sümpfen und Feuchtgebieten Westfalens viel, viel mehr von uns. Auch meine Verwandten, die Knoblauchkröte und die Kreuzkröte, gab es hier in Hülle und Fülle. Sogar die Geburtshelferkröte war bei uns zuhause. Was ganz praktisch war, wenn sich die Wehen in die Länge zogen.
Manni: Was?
Kunigunde: Nee, war nur Spaß. Aber es ist mein Ernst, dass fast alle anderen aus dieser Gegend verschwunden sind. Nur wir Erdkröten halten noch die Stellung. Doch auch wir sind längst nicht mehr so zahlreich wie früher.
Manni: Das trifft auch auf uns Molche zu. Wir sind zwar nicht vom Aussterben bedroht, doch auch unsere Zahl hat abgenommen. Teichmolche, die bis zu elf Zentimeter lang werden, sind hier in Dorsten am häufigsten. Aber bei weitem nicht so imposant wie wir Kammmolche. Wir werden bis zu 18 Zentimeter lang und man nennt uns wegen unseres prächtig gezackten Rückenkamms auch Wasserdrachen.
Kunigunde: Und was ist mit den Fröschen, Felix?
Felix: Quak?
Manni: Was?
Kunigunde: Er hat gesagt, dass er zu den Grasfröschen gehört, die in unserer Region am häufigsten sind. Und dann gibt es noch Seefrösche, die in Flussniederungen leben und sich hier seltener blicken lassen und den Kleinen Wasserfrosch, der in Waldweihern zuhause ist. Ausgerechnet der Bastard aus den beiden Arten, der Teichfrosch, kommt vergleichsweise häufig vor. Schließlich ist da noch der Moorfrosch, den man in Dorsten nur noch ganz selten antrifft. Die Männchen sind ziemliche Angeber, die färben sich ein paar Tage lang zur Laichzeit im Frühling knallblau, um den Weibchen zu imponieren. Das hat der Winzling wohl auch bitter nötig: Er wird höchstens sieben Zentimeter lang.
Felix: Quak!
Manni: Aber wie ist der starke Bevölkerungsschwund zu erklären?
Kunigunde: Das hat mehrere Gründe. Die rücksichtslosen Zweibeiner haben die Natur fast überall ihren Bedürfnissen angepasst und verändert. Unsere Laichgewässer wurde oft zugeschüttet oder so stark verschmutzt, dass keine verantwortungsbewusste Krötenmutti dort ihre Kinder zur Welt bringen wollte. Und dazu kommt noch, dass unsere Geburtsgewässer, die wir zur Vermehrung aufsuchen, von oft stark befahrenen Straßen abgeriegelt sind. Und diese verantwortungslosen Mörder denken überhaupt nicht daran, solche Straße wenigstens nachts, wenn wir unterwegs sind, für uns abzusperren!
Manni: Warum gebt Ihr nicht selber Gas und springt zügig auf die andere Seite?
Kunigunde: Nun mal langsam, Freundchen! Wenn Du bei Deiner anstrengenden Wanderung in der Dämmerung aufwachst, bist Du noch ziemlich beduselt. Und außerdem ist eine Erdkröte kein D-Zug. Wir brauchen etwas Zeit. Wenn wir Pech haben, schleppen wir auf dem Rücken auch noch ein, zwei Männchen mit, die sich an uns klammern. Ich kann ja verstehen, dass sie von meiner Schönheit so betört sind, dass sie mich nicht mehr loslassen wollen, doch das kann eine ganz schöne Last werden.
Manni: Aber die Reifen von den Zweibeiner-Autos sind doch ziemlich schmal. Wieso zerfetzt es so viele von Euch?
Kunigunde: Es reicht, wenn sie über uns schnell hinwegrollen, auch ohne uns zu berühren. Es ist der Unterdruck, der uns killt. Aber Physik wird an der Molch-Schule wohl nicht unterrichtet.
Manni: Dafür habe ich schon beobachtet, dass es Zweibeiner gibt, die im Februar lange Zäune am Straßenrand aufstellen. Dort plumpsen Kröten und Frösche dann in Eimer, und die Zweibeiner bringen Euch bis zum Ende der Laichzeit zur anderen Straßenseite oder direkt zum Laichgewässer. Aber über Eimer-Fallen wird an der Krötenschule wohl nicht gesprochen. Oder seid Ihr einfach zu blöd?
Kunigunde: Hüte Deine Zunge, Du Molch! Wir sind bloß clever, weil wir genau wissen, dass wir so sicher über die Fahrbahn gelangen. Übrigens sind gelegentlich auch ein paar Artgenossen von Dir im Eimer. So viel zum Thema Blödheit… Und die Zweibeiner, die auf diese Weise schon unzählige Leben gerettet haben, sind übrigens vom NABU oder sie helfen dem Naturschutzbund. Wir sind ihnen dafür sehr dankbar. Ich habe mich mal umgehört. Allein 2024 hat der NABU in Dorsten fast 1900 Amphibien das Leben gerettet! In Krötenkreisen heißt es daher: Weitersagen! An der Gälkenheide am Rand des Marienviertels, am Schloss Lembeck und Im Schöning, nahe der Einmündung in die B 58 zwischen Wulfen und Deuten, stehen Krötenzäune. Nutzt den NABU-Service!
Manni: Felix, sei kein Frosch, sag auch mal was dazu.
Felix: Quak!
Felix (schriftlicher Nachtrag): Jeder weiß, dass wir Amphibien nicht sprechen können wie die Menschen. Wenn wir das versuchen, werden wir sofort unglaubwürdig. Deshalb habe ich mich auf meine natürliche Lautäußerung beschränkt und stattdessen diesen Text geschrieben. Quak!
——————————————————————————————————————————————-
Helferinnen und Helfer gesucht
Alle Aktiven des NABU Dorsten freuen sich über weitere Interessierte, die uns beim Auf- und Abbau der Zäune, sowie bei der täglichen Kontrolle helfen wollen. Sie können auf unserer Homepage Ansprechpartner finden oder auch die Freiwilligen an den Zäunen treffen und ansprechen. Gerne können auch einmal Familien mit ihren Kindern dazukommen, gucken und helfen. Besonderen Spaß macht es die freigelassenen Kröten glücklich in ihren See schwimmen zu sehen.
Eine dringende Bitte noch: Leeren sie die Eimer an den Krötenzäunen nicht unabgestimmt, denn der NABU zählt alle Amphibien und führt eine Statistik.
Petra Nitschke-Kowsky
Storchberichte aus dem Hervester Bruch Frühjahr und Sommer 2020
Unornithologische Beobachtungen

Der Hervester Bruch und der tägliche Radweg

Wege und Straßen durch den Hervester Bruch und die Lage der drei Storchen-Nester*
*Hier wird unornithologisch durchgehend von „Nestern“ geschrieben. Richtig handelt es sich um „Horste“.
Einige Eindrücke aus dem Hervester Bruch



Die Landschaft bei Nest No. 1, das Nest No. 1 und das Baumnest


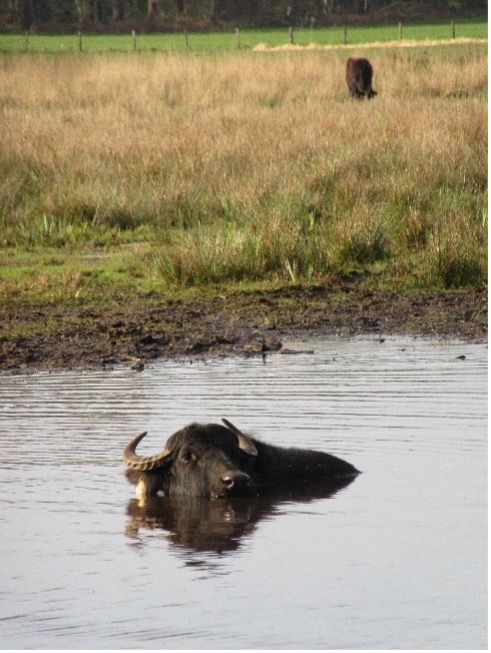

Das Nest No. 2, die Landschaft am Nest No. 2, Wasserbüffel im Wasserbüffelsumpf, der Entwässerungsgraben
Storchberichte
17.3.2020
Das Brutpaar (Nest No.1) kümmert sich vorbildlich um die Eier. Erst waren sie zu zweit im Nest, dann hatte einer Ausgang (Ausflug 😊)
Das andere Paar gönnt sich noch ein bisschen Freiheit und stakst gemeinsam durch die Seenlandschaft. Sehr schön und beruhigend.
18.3.2020
Ob es da eine Auseinandersetzung beim Storchenpaar gibt? Nur physisch oder auch emotional? Neue Aufregung am anderen Storchennest (Baumnest)! Ein Paar sorgt sich um das Nest, denn nicht zu weit entfernt sitzt das andere Paar im Baum und klappert! Was wird das?
19.3.2020
Das jung verliebte Paar steht nun immer noch frei auf dem Horst. Das Paar in der Familienphase verhält sich vorbildlich. Der einsame Storch war heute nicht zu sehen.
21.3.2020
Der einsame Storch fand es doch zu langweilig und hat seine Clique von vier weiteren Störchen herangeholt. Diese segeln draufgängerisch in großen Kurven durch den heftigen Wind, versuchen zwischendurch in den Bäumen zu landen, kreisen dann wieder hoch in den Himmel. Das jung verliebte Paar saß zunächst brav auf dem Horst, hat sich dann aber anstecken lassen und sogar ein Storch aus der Familienphase konnte nicht darauf verzichten, noch einmal mitzufliegen. Manchmal gab es kleine Zickereien und Kämpfchen und sogar klappern konnten einige im Fluge.
23.3.2020
Heute stolzieren zwei verliebte Storchenpärchen durch die Sümpfe und fanden ein leckeres Häppchen nach dem anderen. Der geduldig brütende Storch musste von oben hungrig runter sehen, denn seine Unterstützung ist nirgends zu sehen und lässt auf sich warten.

Das dritte Pärchen stakst durch den See
24.3.2020
Heute sind alle drei Paare friedlich zusammen, das eine beim abendlichen Staken durch den See, das zweite sitzt im Baum und das Brutpaar gemeinsam auf dem Horst (Nest No. 1).
25.3.2020
Das Brutpaar ist nach wie vor entspannt und einer sitzt treu auf den Eiern. Die andere steht fürsorglich dabei, hat dann aber „Ausflug“. Im Baum ist es wieder aufregend, denn der einsame Storch buhlt um die bereits vergebene Störchin. Das Paar steht gemeinsam im Nest und klappert sich verliebt an. (Gestern habe ich sie sogar beim „vögeln“ beobachtet.) Ob der Nebenbuhler gewinnen kann? Das dritte Pärchen stakst, wie jeden Abend entspannt durch den See. Sie genießen das gemeinsame Leben vom „Sumpf in den Schnabel“ ohne sich Sorgen zu machen.
26.3.2020
Heute eine entspannter und ruhiger Storchentag…fliegen sie jetzt auch auf „social distancing“? Die Storchenmama[1]* im Nest No. 1 brütet entspannt, der Storchenpapa war zunächst nicht zu sehen. Das verliebte Pärchen stakst, wie jeden Abend durch den See. Sie wollen sich wohl so richtig kugelrund fressen, bevor es in die Familienphase geht. Drücken wir die Daumen, dass das in-die-Luft-schwingen dann noch klappt. Schließlich finde ich auf neuen Wegen auch noch den Storchenpapa alleine durch die Wiesen schreiten und Häppchen schnappen. Das dritte Paar ist wohl auf der Flucht vor dem Nebenbuhler.
[1] Storch- Mama oder -Papa werden hier und im Folgenden nach dichterischer Freiheit zugeordnet. Biologische konnte ich das nicht unterscheiden.

Im Baumnest…
27.3.2020
Im Herankommen sehe ich auf dem bisher unbewohnten Storchenhorst (Nest No. 2) etwas stehen, aber was ist das? Tatsächlich ein Nilganspaar! Der Ganter steht, schaut in die Landschaft und sieht ab und zu mit Respekt in die Tiefe. Die Gans hat sich gemütlich eingekuschelt und findet das Plätzchen offensichtlich gemütlich. Ist das Gänse-like?


Das Nilganspaar im Nest No. 2
Im anderen Nest (Nest No. 1) herrscht gemütliche Brutruhe. Kein zweiter Storch zu sehen, nicht einmal bei den anderen Gewässern. Und das andere Storchenpaar? Du kannst es erraten: Frisst sich wie immer an „seinem“ See voll. Fast schon ein bisschen langweilig? Beim genauen Hinsehen habe ich oberhalb des Knies eine Verdickung entdeckt. Ob der Ring hochgerutscht ist? Auf dem Rückweg sehe ich, dass die Gänse sich eines Besseren besonnen haben: Das Nest ist wieder leer. Vielleicht hat sich das Paar auch beraten und ist zu der Erkenntnis gekommen, dass es für die Küken dort oben zu gefährlich wäre.
Später nachgelesen: Nilgänse nisten tatsächlich in Bäumen oder Vogelhorsten.
28.3.2020
Heute waren nur drei Störche zu sehen: Der liebevoll brütende Elternstorch und das Paar. Dieses gönnte sich heute einmal eine Abwechslung und stakst durch die Gewässer der Wasserbüffel.
29.3.2020
Heute endlich hat sich das zweite Pärchen entschlossen auch die neue Lebensphase zu beginnen. Die Storchenfrau sitzt als ob sie jetzt brüten würde. Herr Storch beugt sich herunter, als würde er seiner Herzdame kurz ins Ohr flüstern: “Ich bin gleich wieder da.“ Und schwingt sich in die Lüfte. Das erfahrene Brutpaar hütet gemeinsam das Nest. Kein Nebenbuhler stört die Idylle.

Endlich niedergelassen im Nest No. 2
30.3.2020
Heute sehe ich schon im Ankommen, dass endlich einer der Störche des zweiten Paares auf dem zweiten Nest sitzt, bei der hereingebrochenen Eiseskälte und dem Regen!

Während ich zum ersten Nest fahre sinniere ich über die Gedanken und Gefühle des Storches: Ob er wohl voller Sehnsucht an die unbeschwerten, sonnigen Tage gemeinsam mit dem Liebsten am See stolzierend zurückdenkt? Oder ob er außen kalt unter sich die wohlige Wärme und die glatten Eier fühlt und voll Spannung auf die kommende Zeit hofft? Vielleicht sitzt er auch einfach und fühlt, dass er trotz aller Widrigkeiten des Lebens genau jetzt und hier an der richtigen Stelle seine Aufgabe erfüllt? Jedenfalls sitzt der zweite Storch auch stoisch auf seinen Eiern. Keiner der Partner ist zu sehen.
Auf dem Rückweg finde ich den Storch stehend auf seinem Nest No.2. Ob es doch noch keine Eier gibt? Alle Gedanken umsonst?

Bei Wind und Wetter oben auf Nest No. 2
31.3.2020
Heute radle ich bei schönstem Sonnenschein und nachlassender Kälte ´rüber. Erleichterung: Der zweite Storch sitzt auf dem Nest und brütet wohl! Auch auf dem Nest No. 1 herrscht Brutruhe. Nur ist dieser Storch etwas unruhig und guckt nach unten. Ob er schon Leben in den Eiern spürt? Auf der Rückfahrt durch die Wiesen kann ich auch beide Partner jeweils nicht sehr weit weg von ihren Nestern durch die Wiesen staksen sehen. Welch eine Ruhe!
1.4.2020
Heute ein sonniger und schon etwas wärmerer Tag. Im neuen Storchennest No. 2 sitzt der Storch und brütet, steht auf, dreht wohl die Eier, setzt sich, steht wieder, zupft ein paar pieksende Hälmchen raus und wirft sie über den Nestrand, lässt sich schließlich wieder nieder… nun scheint es bequem zu sein. Im Nest No. 1 herrscht absolute Ruhe. Ich sehe nur ein paar weiße Federn, nichts bewegt sich. Oh, hoffentlich ist er nicht erfroren?! Nein, schließlich erscheint doch einmal ein roter Schnabel. Ich bewundere insgeheim diese Ruhe und Geduld in der Gleichförmigkeit der Tage. Kann uns ein Vorbild sein in dieser reduzierten Zeit. Keine Storchenpartner zu sehen. Ob sie sich in den Lippe-Wiesen vergnügen?
2.4.2020
Bei irgendwie neutralem Wetter – weder pustet mir Wind und Regen ins Gesicht, wie vorgestern, noch lacht mir die Sonne ins Herz, wie gestern, der Himmel einheitlich grau, die Luft weder kalt noch warm, radle ich zum neuen Nest (No. 2). Dort guckt mich der brütende Storch mit hoch erhobenem Kopf an, es ist, als würde er mich begrüßen. Er guckt nach rechts, nach vorne über die Landschaft und wartet wohl auf Ablösung. Ein weiterer Beobachter zeigt mir den zweiten Storch ganz hinten in den Wiesen der Wasserbüffel. Und noch etwas Neues erfahre ich: Die Störchin ist beringt und das kann die verdickte Stelle oberhalb des Knies sein. Auf zum alten Nest (No. 1). Der brütende Storch ist tief ins Nest gekuschelt und man sieht ihn kaum, aber unten stolziert der Zweite. Und im Baum sitzt tatsächlich das zurückgekehrte dritte Paar! Einer schwingt sich herunter und bringt ein paar Zweige nach oben. Dazu muss er erst einige Meter vom Baum weg staksen, um ausreichend Startbahn zu haben. Lange und sorgfältig wird das Material eingebaut. Das steckt wohl den anderen Storch auch an. Er bringt seiner Liebsten auch ein Zweiglein hoch. Das dritte Paar verlässt sein Nest und fliegt in großen synchronen Bögen in die Ferne. Heute wieder sechs Störche! Ich radle zufrieden nach Hause.
3.4.2020
Heute war es wieder ein spannender und überraschender Storchtag. Aber von vorne: Zuerst komme ich ja immer an das neue Nest (No. 2), aber heute sehe ich schon mit inzwischen geübtem Auge einen der beiden in den Wasserbüffelwiesen herumstolzieren. Im Nest gemütlich Ruhe. Nach ein bisschen Zuschauen fahre ich weiter und höre plötzlich fröhliches Begrüßungsklappern vom Nest: Tatsächlich kriege ich jetzt den Brutwechsel mit. Einige Zeit stehen beide im Nest, dann fliegt der eine weg und der andere lässt sich vorsichtig nieder. Am ersten Nest (No. 1) dann die Überraschung, nein noch keine geschlüpften Küken, aber im nahen Baum vier Störche! Zwei stehen dicht neben einander auf dem Nest, so dass ich nur an den vier roten Beinen überhaupt erkennen kann, dass es zwei sind. Dann im Geäst noch zwei weitere Störche. Lustig: wenn sie den Stand wechseln, wird der Schnabel als drittes Bein benutzt und die Flügel halten das Gleichgewicht. So große Vögel zwischen den Zweigen – erstaunliches Bild! Plötzlich schwebt ein weiterer im großen Bogen über dem Baum und verschwindet wieder. Einer der noch nicht fest verpaarten Störche klappert und balzt mit aufgeplusterten Flügeln und Schwanzfedern. Ob die beiden keinen guten Nistplatz finden? Fröhlich radle ich wieder nach Hause.

Suchbild: Vier Störche im Baum!
5.4.2020
Also heute: „in allen Nestern ist Ruh‘, über allen Wipfeln spürst Du kaum einen Hauch….“ Jetzt breche ich das umgedichtete Zitat schnell ab, sonst wird es pathetisch. Also jeder der beiden Störche saß auf seinem Nest bei herrlichem Sonnenschein und warmen Temperaturen. Und nach einiger Zeit stand plötzlich auch ein Storch auf dem Nest im Baum. Ob dieses Paar so lange zögert, wie das andere, bis es sich endlich zum Brüten niederlässt? Von den Partnern niemand zu sehen.
6.4.2020
Langsam und ganz entspannt radle ich heute bei warmem Wetter ´rüber. Was wird mich heute erwarten? Im neuen Nest (No. 2) ein friedlich brütender Storch und ebenso im ersten Nest. Aber beide Störche stehen einmal auf, zupfen hier etwas raus, sortieren das Moos, drehen wohl auch mal die Eier und lassen sich dann vorsichtig wieder nieder. Bei genauem Nachdenken ist es doch sehr erstaunlich, was sich die Natur so an Vorgängen „ausdenkt“, was für verschiedene Verhaltensweisen sich entwickeln…. Auf der Rückfahrt entdecke ich auf der Außenrunde noch einen Partner in den Wiesen. Das Baumnest heute leer. Heute also ein ruhiger Storchtag.
8.4.2020
Gestern war alles ruhig und entspannt: Im Ankommen sehe ich schon den einen Storch ziemlich nah am Weg durch die Wasserbüffelsümpfe staksen, der andere sitzt ruhig auf seinem Nest, muss nur einmal aufstehen, ein paar Hälmchen und Zweige sortieren und Eier drehen, dann lässt er sich wieder nieder. Genauso sieht es auch am ersten Nest (No. 1) aus. Nach einiger Zeit kann ich dort die Ablösung in eleganter Kurve einsegeln sehen.
Das Baumnest war gestern leer. Dafür gibt es heute dort wieder Aufregung: Zwei Störche stehen dort ganz friedlich. Plötzlich wildes Geklapper und ein dritter Storch versucht zu landen. Kurzer, heftiger Kampf, dann fliegt er runter auf den Boden und stakst um den Baum. Immer wieder wütendes Geklapper von oben. Zweiter erfolgloser Versuch, dann segelt er davon. Ich frage mich, ob es ein Nebenbuhler ist oder der Storchpapa von nebenan, der keine „Nahrungskonkurrenten“ in der Nähe möchte. Auf beiden Brutnestern herrscht dagegen gemütlich Ruhe.
9.4.2020
Heute ein ruhiger Storchentag: Beide Brutnester treu, aber nur einfach ohne den Partner besetzt. Einen Storch habe ichwieder in den Wasserbüffelwiesen entdeckt. Im Baumnest stehen wieder die beiden Störche, heute ganz unbehelligt. Ein Mann neben mir beobachtet ebenfalls das Getier in den Wiesen und auf den Nestern und berichtet mir von einem weiteren Storchenpaar in Lippramsdorf nur 8 km von hier, ganz schnell mit dem Rad zu erreichen… Ich radele lieber entspannt nach Hause.
11.4.2020
Dieses Mal schon am frühen Nachmittag und zu zweit ganz gemütlich und entspannt beim ersten Nest und beim Baumnest. Erste Entdeckung: Tatsächlich brütet nun das Paar im Baumnest auch, endlich haben sie sich entschieden! Aber offensichtlich hat dieser Storch noch nicht so die innere Einstellung dazu gewonnen. Während im ersten Nest große Ruhe herrscht, steht der Storch im Baumnest auf, zupft ein paar Stöckchen zurecht, setzt sich wieder, steht schon wieder auf. Schließlich verlassen ihn die Nerven und er fliegt ab und lässt das Gelege unbeaufsichtigt. Direkt über uns schwebt er davon. Ein herrlicher Anblick, aber was ist mit den Eiern?

Der Brutstorch aus dem Baumnest segelt davon.
Es dauert nicht lange und drei Störche kommen zurück. Offensichtlich wurden sie zur Unterstützung herangeholt und damit sie keinen Unsinn treiben. Bald sind in beiden Nestern jeweils zwei Störche. Das gemütlich geduldige Warten hat sich gelohnt.
12.4.2020
Heute mit etwas weniger Gemütsruhe an allen drei Nestern vorbei geradelt. Alle waren treu von einem Brutstorch besetzt. Auf der Weiterfahrt nach Lippramsdorf sehe ich plötzlich die drei anderen Störche friedlich vereint auf dem frisch gepflügten Feld herumstolzieren und immer wieder Schnabel-stochernd etwas finden. Eine gemütliche Männerrunde vor der großen Herausforderung viele Küken satt zu kriegen? Ich habe mir ausgerechnet, dass das erste Brutpaar gut in dieser Woche dran sein könnte. Im zweiten Nest kann man ab dem 2. Mai etwas erwarten und im Baumnest ab 15. Mai. Das wird eine spannende Zeit!
13.4.2020
Heute nur ein knapper Bericht, da ich nur mit meiner supersportlichen Freundin im Vorbeimarschieren Blicke auf die Nester und in die Wiesen werfen konnte. Gleich vorne anstolziert ein Storch ganz nah am Weg durch die Wasserbüffelsümpfe. Wunderbarer Anblick so nah! Der zugehörige Partner sitzt treu auf dem Gelege und brütet (Nest No. 2). Im ersten Nest auch noch keine Veränderung. Ich warte jetzt jeden Tag auf das Schlüpfen der Küken. Gerade frage ich mich, wie lang eigentlich wohl die Kükenschnäbel in den Eiern sind und wie sie wachsen. Die gute Storchendame im Baumnest ist immer noch von Unruhe geplagt und lässt ihre Eier für Momente allein. Kein Partner zu sehen und schon sind wir vorbeimarschiert. Nach mehr als 10 km Wanderung bin ich heute zu müde, mich noch einmal auf´s Rad zu schwingen.
14.4.2020
Heute radle ich schon ziemlich müde bei kühlem, aber schönem Wetter rüber. In allen drei Nestern gleichförmiges Brutleben, Sinn-volles Nichtstun in froher Erwartung. Nach ein wenig Warten gibt es am Nest No. 1 den Wachwechsel. Aber offensichtlich ist noch keine Küken geschlüpft. Ich warte jetzt jeden Tag darauf. Im Baumnest heute ruhiges Brüten. Ist hier auch die leichte Unruhe durch friedliches, erwartungsfrohes Sitzen abgelöst? Auf der Nach-Hause-Fahrt sehe ich noch einen Storch große Kreise segeln und offensichtlich guckt er sich dabei die Landschaft genau an. Übrigens genießen zwei Wasserbüffel das Bad im sumpfigen Wasser.
15.4.2020
Bei schönem Sonnenschein drei friedlich brütende Störche, auch im ersten Nest noch kein Schlupf auszumachen. Einen Brutwechsel beobachtet und lustig, einen rückwärtigen Schuss aus dem Nest… immer schön sauber halten!

Wachwechsel am Nest No. 1
Donnerstag, 16.4.2020
Heute bei schönstem Sonnenschein zu zweit auf zu den Störchen. Im zweiten Storchennest gemütliches Brüten, aber ich sehe auch den leicht geöffneten Schnabel, denn die Sonne brennt ihr wohl aufs Hirn, doch leider fehlt der Sonnenschirm….Der Storchenmann stakst heute einmal in der ferne am Seeufer entlang, dort, wo sonst der Fischreiher auf Beute lauert. Ganz gespannt radeln wir zum ersten Storchennest. Ob die Jungen geschlüpft sind? Nein, hier ist das Leben noch ein ruhig fließender Fluss, geduldiges Warten ist gefragt. Auch hier stakst eine Storchenmann durch den Ufermorast des kleinen Sees. Von ganz Nahem können wir beobachten, wie er immer wieder schnell mit dem Schnabel zusticht, aber scheinbar entwischt seine Beute immer wieder, denn schlucken sehen wir ihn nicht. Dann spiegelt er sich wunderbar im Wasser! Eine Nutria zieht, wie ein Langstreckenschwimmer seine Bahn ruhig durch den See. Den Storch stört es nicht, aber das Blesshuhn jagt ihn, wohl weil er zu dicht am Nest vorbei schwimmt. Im Hintergrund spaziert ein Fasanenpärchen. Herrlich ruhiges Frühlingsleben.
17.4.2020
Große Überraschung bei den Störchen, aber ganz anders als erwartet. Zunächst am Nest No. 2alles in üblicher Ruhe und ebenso beim Nest No. 1. Leider noch kein erhöhter Flugverkehr, keine Fütterung, also noch nichts geschlüpft und wir müssen uns noch gedulden. Aber was balanciert denn da auf dem Ende des abgesägten Astes direkt beim dritten Storchennest? Da steht tatsächlich eine Nilgans und versucht vorsichtig den dicken Ast herunter zu klettern Richtung Storchennest! Und der Storch brütet entspannt und stört sich nicht daran. Erst als der Storchenmann kommt, fliegt die Nilgans auf, landet aber direkt in Baumnähe und läuft dort unruhig herum. Einen Moment beobachte ich das andere Nest und da: Schon wieder sitzt die Gans diesmal direkt

Am See bei Nest No. 1
neben dem Nest und guckt wie unbeteiligt in die Landschaft. Der Storchenmann beäugt sie die ganze Zeit kritisch, lässt sie aber dort sitzen. Was wird das? Ein tierisches Reihenhaus? Oder eine WG und man teilt sich die Brutarbeit? Ich bin gespannt, was ich dort morgen beobachten kann. Ein anderer Beobachter erzählt mir, dass das Gänsepaar dort gestern gemeinsam im Nest saß und später erst von den Störchen verjagt wurde. Ob da nun ein gemischtes Gelege im Nest liegt? Immer wieder eine Überraschung.
18.4.2020
Der Himmel hat die Luft gewaschen und die Erde besprengt, die Pusteblumen stehen da, mit struppigen Köpfchen und in alle drei Nestern ist nun die Pflege des Federkleides angesagt. Eine putzt und kratzt sich und schüttelt die Flügel im Stehen, die anderen Beiden putzen sich im Sitzen. Keine Schlüpfung zu beobachten, keine Gans, die sich einquartieren will, nur die drei Damen bei der „Nach-dem Regen-Toilette“…. Und dann noch ein Storchenmann, ganz nah am Weg wunderschön anzusehen, schwarz-weiß-rot in der frisch gewaschenen knall grünen Wiese.
Sonntag, 19.4.2020
Heute wieder einmal ein ganz ruhiger, unaufgeregter Storchentag. Ruhe im zweiten Nest und der Partner schreitet unten am See im tiefen Gras entlang. Leider noch keine Überraschung im Nest No. 1. Im Baumnest kommt der Storchenmann vorbei, aber kein Begrüßungsgeklapper! Gemeinsam zupft man ein wenig im Nest herum, dann ist er schon wieder weg. Ehealltag?


Der Storch am See in der Nähe des Nestes No. 2
Montag 20.4.2020
Heute entspannte Ruhe in allen drei Nestern und tatsächlich zeigen sich heute auch alle drei Partner! Zuerst der Brutwechsel im Baumnest. Offensichtlich ist die saisoneheliche Stimmung wieder gerettet. Der Wechsel ist wieder mit freundlichem Geklapper begleitet. Dagegen geht es im Nest No. 1 heute still zu beim Wechsel. Nach Abflug des Weibchens hantiert – oder sollte ich besser sagen schnabuliert – der Storchenmann lange im Nest herum. Ob es ihm nicht ordentlich genug war? Es sieht aber nicht nach einer Fütterung aus. Auf dem Rückweg steht auch der Partner auf Nest No. 2. Alles in Ordnung bei Storchens – nur der Nachwuchs scheint mir verspätet.
Dienstag, 21.4.2020
Heute haben sich wieder alle sechs Störche gezeigt und in jedem Nest freundliches Geklapper bei der Ankunft des Liebsten. Wie schön kann das Leben sein. Und im Nest No. 1 beobachte ich ausgiebiges Schnäbeln des Storches. Vielleicht ist das schon eine erste Fütterung? Vielleicht erwarte ich viel zu viel Veränderung mit dem Schlüpfen? Vielleicht werden die Kleinen lange gewärmt und zunächst nur seltener gefüttert? Also ich nehme einmal an: Sie sind geschlüpft! Mehr werde ich vielleicht morgen sehen.
Mittwoch, 22.4.2020
Heute bei schönstem Frühlingswetter, blauem Himmel, strahlender Sonne und angenehmer Wärme treffen wir nur drei sehr ruhige Storchdamen beim Brüten und beim Wärmen der Jungen. Keine Partnerstorche zu sehen. Das Schönste heute war ein kleines Heckrindkalb, dass fleißig Milch saugt und ein wenig hölzern noch durch die Gegend springt.
Donnerstag, 23.4.2020
Heute ein wunderbarer frühsommerlicher Tag, heute zu zweit auf Storchtour. Heute fahren wir am zweiten Nest vorbei, zu viele Leute. Auf der Wiese und am See des ersten Nestes spazieren in Harmonie zwei Störche durch den Sumpf und See und finden ein leckeres Häppchen nach dem anderen. Im ersten Nest steht die fleißige Störchin und beugt sich zu den Jungen, schnäbelt hier und da und verteilt offensichtlich Futter. Nach einer Weile erscheint der Storchenmann mit freundlichem Geklapper und übernimmt die Aufgabe. Die Störchin darf abfliegt. Auch im Baumnest freundliche Geklapper, als der Partner auftaucht. Auf dem Rückweg sehen wir auch in einem wunderbaren Gleitflug den zweiten Storch am zweiten Nest auftauchen. Alles begleitet von dauerndem Froschgequake.

Keine Jungen zu sehen, aber wahrscheinlich schon geschlüpft
Freitag, 24.4.2020
Heute Aufregung am Nest No. 2! Ein Storch landet auf dem Nest mit der brütenden Störchin und wird sofort vertrieben, flüchtet auf einen Baumstamm. Er kreist noch mehrfach über dem Nest und verschwindet dann. Schließlich erscheint der richtige Partner und wird mit freudigem Geklapper begrüßt. Auch er kreist danach noch einige Runden über sein Revier vielleicht, um den Eindringling zu verjagen. Wer war das? Am Nest No. 1 wärmt die Störchin ihre Jungen in Ruhe.

Ein falscher Storch nähert sich dem Nest No. 2.

Sicher ist sicher: Ein Rundflug übers Nest.
Samstag 25.4.2020
Heute ruhiges Storchenleben unter den Brütenden. Kein weiterer Storch zu sehen. Auf dem Nest No. 1 steht die Störchin auf und schein sehnsüchtig in die Landschaft nach ihrem Partner zu schauen. Schließlich kann sie doch noch etwas Futter aus Ihrem Magen hervorwürgen. Sie beugt den Hals mehrfach, öffnet und schließt den Schnabel und schließlich füttert sie ein wenig ihre Jungen und lässt sich dann wieder nieder. Der Rest muss später folgen, wenn der Storchenvater mit frischem Futter kommt.
Sonntag, 26.4.2020
Heute wieder große Brutruhe auf dem Nest No. 2. Stattdessen muss ich einmal von einer großen Nutria berichten, die durch den See schwimmt und wütend von einem sich aufplusternden Blässhuhn verfolgt wird. Auch im Baumnest tiefe Brutruhe. Aber zum Nest No. 1 kommt gerade der liebevolle Storchvater mit einem Schnabel voller Polstermaterial für seine Jungen angesegelt. Er verbaut das Material liebevoll, dann hat die Störchin frei – Ausflug – und er füttert seine Süßen. Immer wieder würgt er etwas hervor und verteilt es gleichmäßig. Ich radele froh und beruhigt nach Hause, die Storchwelt ist in Ordnung.

Das Storchenpaar am Nest No. 1 beim Bauen und Junge hüten.
Montag, 27.4.2020
Gemütliches Brüten im Nest No. 2 und im Baumnest, mal Aufstehen und die langen roten Beine vertreten, sorgfältig die Eier drehen und dann wieder niederlassen. Im Nest No. 1 gibt es schon etwas mehr Arbeit. Nach dem Hinstellen etwas Futter aus dem Magen hervorzaubern und gerecht verteilen. Ich wundere mich, dass selbst nach langer Ruhe noch etwas Futter für die Jungen im Magen ist. Heute kein Partner zu sehen.
Dienstag, 28.4.2020
Auf dem Nest No. 1 sitzt Mutter Storch und wärmt ihre Jungen. Vater Storch steht entspannt daneben und scheint die Ruhe und Vollständigkeit des Lebens zu genießen.
Zum Baumnest kehrt auch der Partner zurück, langes zärtliches Geklapper. Ein ruhiger Abend im rötlichen Abendlicht.
29.4.2020
An der Wiese von Nest No. 1 und dem Baumnest sitzend formuliere ich schon in Gedanken: Das Einzige, was die schon fast langweilige Nestruhe etwas unterhaltsamer macht, sind heute die Heckrinder, denen offensichtlich der Regen gutgetan hat und die lustig durch die Wiese galoppieren. Aber da steht Mutter Storch auf, zupft und pflegt ihr Federkleid und beugt sich zu ihren Jungen herunter und da, da sehe ich zum ersten Mal einen langen, dünnen Hals, ein Köpfchen und einen bettelnd aufgerissenen Schnabel, der sich wankend nach oben streckt und dann wieder im Nest verschwindet! Und dann noch einmal, Hals und Kopf etwa halb so lang, wie Mamas Schnabel. Immer wieder taucht etwas auf, aber immer nur einer gleichzeitig. Wie viele es wohl sind? Unten am See quakt das Futter!

Der erste Blick auf ein Junges in Nest No. 1
30.4.2020
Heute der etwas andere Storchbericht:
Worin unterscheidet sich das Niederlassen eines Brutstorches von dem eines Storches, der Küken hat? – Ein Brutstorch lässt sich etwa so nieder, wie ein alter Mann in den Sessel: Er knickt die Knie etwa halb, zielt und lässt sich dann plumpsen. Er weiß scheinbar, wie stabil Eier sind. Ein Storch mit Jungen steht schon einmal etwas merkwürdig breitbeinig im Nest – nur ja kein Küken verletzen- breitet dann liebevoll seine Flügel aus und lässt sich ganz langsam nieder.
2.5.2020
Storchbericht vom 1. Und 2. Mai:
Bei Regen und kaltem Wetter herrscht große Ruhe in den Nestern. Kein Storch-Paar zu sehen. Heute konnte ich tatsächlich noch einmal Schnäbel und Hälse von2 Jungen aus Nest No. 1 sehen. Die Armen müssen nun die Nacht in einem feuchten Nest verbringen.
3.5.2020
Heute bin ich zuerst bei Nest No. 1 und erlebe gerade den Wachwechsel und danach eine Fütterung und gründliche Säuberung des Nestes. Im Baumnest gemütliches Brüten.
Aber im Nest No. 2 scheint es so weit zu sein! Die Störchin (erkennbar am Ring) arbeitet intensiv! Sie säubert das Nest, schluckt immer wieder runde schwarze Klümpchen und man könnte denken, dass sie auch füttert. Bin gespannt auf Morgen!
4.5.2020
Heute steht bei lauem Wind und schönem Sonnenschein Mutter Storch einbeinig auf Nest No. 1. Ich kann nicht einmal sagen, dass sie ihre runden ca. 3 kg auf dem dünnen Bein balanciert, denn sie steht so sicher und putzt und kratzt sich, verdreht den Hals, um noch an die entfernteste Stelle zu kommen, sieht manchmal aus, wie ein zerzaustes Federknäuel und wackelt dabei kein winziges bisschen! Ja, auch als junge Mutter muss man seine Schönheit pflegen! Gelegentlich bekommen die Jungen ein wenig Zuwendung und Nahrung, aber dann widmet sie sich weiter der Körperpflege. Dagegen sitzt die Störchin im Baumnest unscheinbar, fast farblos und still ins Nest gedrückt. Heute nicht ihr Tag? Im Nest No. 2wird nach dem Wachwechsel eifrig geschnäbelt und gesäubert, immer noch ist es Storchgeheimnis, ob noch glatte Eier im Nest liegen oder schon junges Gemüse wimmelt. Auf ein Neues morgen!

Sind es zwei Junge im Nest No.1?
5.5.2020
Heute wieder bei schönstem Wetter zu zweit zu den Störchen, zuerst zum Nest No. 1. Gleiche Übung, wie gestern: Einbeinig auf dem Nest stehen, die Sonne genießen und gelegentlich ein wenig die Kleinen betütern. Federpflege fällt heute aus, aber da naht die Ablösung. Freundliches Geklapper und dann schnell den Abflug machen, während der Storchenpapa die Fütterung übernimmt. Es sieht aus, als wären es zwei Junge, die die Schnäbel aufsperren.-
Im Baumnest keine Regung… Wie lange habe ich eigentlich den Partnerstorch nicht mehr gesehen? Ist das der Grund für so ein im wahrsten Sinne des Wortes niedergedrücktes Verhalten?
Schnell zum Nest No. 2. Dort haben wir, wie uns andere Storchenfreunde erzähle, tatsächlich gerade die Fütterung verpasst. Also habe ich gestern richtig vermutet! So hoffe ich auf morgige gute Beobachtung.

Auf dem Nest No. 1: Sind es zwei Junge oder sogar drei?
6.5.2020
Heut wieder bei schönem Wetter zu zweit unterwegs. Ziemliche Aktion im Nest No. 1: Vater Storch bringt etwas langes Band-artiges zum Fressen mit und muss selber zupfen, zerren und mit lang gestrecktem Hals herunterwürgen. Aber auch die Jungen haben etwas davon erwischt und versuchen sich daran. Es gibt Streit und sie zerren hin und her. Vater Storch verschließt die Augen und mischt sich nicht ein. Und plötzlich, da sieht man noch ein drittes Köpfchen sich einmischen! Es sind drei kleine Störche!
Im Baumnest unverändert gedrückte Ruhe. Im Nest No. 2 eine kleine Fütterung, aber kein Junges zu erspähen.
7.5.2020
Schon auf dem Hinweg sehe ich zwei Störche in der frisch gemähten Wiese. Mit großen Schritten staksen sie schnell durch das Gras und wirken dabei wie Damen, die mit hohen Absätzen und zu großen Schritten etwas hölzern daherkommen. Warum haben sie es so eilig? Machen die vielen Krähen im Feld sie nervös?
Am Nest No. 2 eifriges Füttern, aber noch keine Köpfchen oder Schnäbel zusehen. Heute reger Flugverkehr am Nest No. 1 und am Baumnest! Hier endlich mal wieder der Partner zu sehen und er bringt mehrfach ein wenig Nistmaterial. Gemeinsam baut das Paar am Nest, bis sich die Störchin wieder niederlässt.
Im Nest No. 1 ein Wachwechsel, treue Fürsorge für die größer gewordenen Jungen. Wenn sie sich strecken reichen sie schon bis an die Federn von Mutterstorch. Ein Kleines übt sich schon im Klappern, es ist zwar nichts zu hören, aber die schnelle Schnabelbewegung ist gut zu sehen.
Spannend!

Im Baumnest mal wieder beide Störche
9.5.2020
Storchbericht von gestern: Am Nest No. 1 wuseliges Leben! Die drei Kleinen strecke sich schon hoch raus und untersuchen schon ein wenig das Nest. Nicht mehr nur Schlafen und Fressen. Nur als Vater Storch anfängt das Nest sorgfältig zu reinigen und aufzuräumen, ist nichts von den Jungen zu sehen. Wie es sich für so Halbstarke gehört, verschwinden sie unauffällig, wenn Mithilfe drohen könnte.
Im Baumnest immer noch Ruhe, aber heute mit hoch erhobenem Kopf.
Im Nest No. 2 offensichtlich eifriges Füttern, aber die Störchlein halten sich noch schön tief im Nest und lassen sich nicht sehen.
10.5.2020
Am Nest No. 2 wieder eine „geheimnisvolle“ Fütterung, kein Junges zu sehen, obwohl das Nest gar nicht tief aussieht. Ob die Gute uns eine Fake-Schlüpfung vorführt? Plötzlich wieder ein fremder Storch im Anflug. Er wird sofort am Landen gehindert und fliegt dann wieder den Baumstamm an. Zwei weitere Störche tauchen auf und staksen um den Stamm durch die Wiese. Was bahnt sich da an? Keine Zeit mehr zu beobachten, denn tiefe schwarze Wolken nähern sich und ein böiger Wind kommt auf. An Nest No. 1 und im Baumnest alles i.O. Und jetzt schnell nach Hause.

Große Aufregung am Nest No. 2: Fremde Störche fliegen an.
11.5.2020
Heute radeln wir wieder zu zweit bei lausiger Kälte und heftige Gegenwind los. In Nest No. 2 eifriges Füttern, aber immer noch großes Geheimnis: Fake oder besonders kleine und zaghafte Küken? In Nest No. 1 steht eine tapfere Störchin in Kälte und Wind. Und da tauchen auch die Jungen auf, erst die zwei Mutigen und dann noch der Nachzügler und wuseln ein bisschen herum. Der Wachwechsel kommt und die Störchin fliegt sofort los.
Im Baumnest – wie kann es anders sein – kuschelige Ruhe.
12.5.2020
Heute am Nest No. 2 liebevolle Pflege des unsichtbaren Geheimnisses und ausführliche Pflege des Federkleides der stolzen Storchmama, die ich an ihrem Ring erkenne. Doch da für einen winzigen Moment ist ein Köpfchen und ein Schnabel zu sehen, wie schön! Eine Mitbeobachterin sah sogar zwei Köpfchen! – Im Nest No. 1 dagegen schon richtig Leben. Zwei Junge gucken raus und schnäbeln schon im Nest herum. Ab und zu taucht auch der kleine Nachzügler dazu auf. Mama Storch guckt liebevoll auf ihre Jungen, vergisst aber auch ihre Körperpflege nicht, wieder mit dem Kunststück auf einem Bein. Die Störchin im Baumnest hat der ganzen Szenerie den Rücken zugekehrt und starrt den Baumstamm an. Sie muss immer noch Brüten und warten. Aber lange kann es nicht mehr dauern.
13.5.2020
Ein eiskalter kurzer Storchbericht an einem der Eisheiligen: Heute fahre ich spät und so schnell rüber, dass mich das Treten warmhält. Im Nest No. 2 wärmt die Störchin ihre Jungen. Aber dann gibt es ein kurzes Häppchen und ich sehe tatsächlich kurz zwei Köpfchen. Jetzt wohnen also insgesamt schon mindestens 11 Störche bei uns! Und die Störchin im Baumnest brütet mit stoischer Ruhe an weiterem Nachwuchs. Im Nest No. 1 fröhliches Wuseln. Nach dem Wachwechsel sieht es so aus, als würden die Kleinen schon selber das vorgeworfene Futter aufpicken. Mutter Storch steht dünn und müde in der Kälte auf dem Nest. Die Ruhezeiten werden immer weniger. Wann hat sie das letzte Mal gemütlich gesessen?
14.5.2020
Gerade komme ich bei schönstem Sonnenschein bei den Wasserbüffelsümpfen an, da sehe ich bereits einen Storch dort am Wasser stehen, auf einem Bein Kopf unterm Flügel. Als ich abrupt bremse, erschreckt er sich und guckt mich prüfend an. Dann schnäbelt er sich peinlich berührt am Bauch. Beim Schlafen erwischt!
Im Nest No. 2 eine kleine Fütterung, wieder kann ich einen kurzen Blick auf ein Junges erhaschen.

Am Nest No. 2 wird eifrig gefüttert, aber die Jungen kann man nicht sehen.
Im Nest No. 1 dagegen machen sich schon drei dicke, hellgraue Wollknäuele breit, gucken mit ihren noch kurzen Hälsen in die Landschaft und eines versucht sogar schon zu stehen. Der Wachwechsel bringt Futter, aber fressen müssen sie nun alleine.
15.5.2020
Heute große Neuigkeit aus dem Baumnest! Jetzt kenne ich mich ja schon ein bisschen aus und erkenne den Unterschied zwischen „Nest säubern und Eier drehen“ und „erste Fütterung von Küken“!. Also bin ich fest überzeugt, dass die Schlüpfung stattgefunden hat und ich sah die stolze und wohlgenährte Mutter sorgfältig füttern und, wenn ich mich nicht irre, sogar an vielen Stellen. Bin gespannt, wie viele Junge es sind.- Die drei Wollknäuele im Nest No. 1 bekommen nun schon die ersten schwarzen Federn Sie stürzen sich auf das Futter, dass Vater Storch liefert.

Nach der Fütterung vorsichtig niederlassen, um die Jungen zu wärmen.
16.5.2020
Kurzer Storchbericht aus dem Nest No. 1. Eines der Wollknäule hat heute schon einen ganzen Moment gestanden, bis ihm plötzlich die Beine weggesackt sind. Neugierig hat es über den Nestrand geguckt und Mutter Storch hat ganz sanft mit dem Schnabel aufgepasst, dass das Kleine nicht aus dem Nest kippt. Das Leben in diesem Nest stiehlt nun ja den anderen beiden ein wenig die Show, denn dort kann man nur mit viel Geduld mal ein wackelndes Köpfchen entdecken. Aber nicht mehr lange, dann gibt es noch mehr Wollknäule zu sehen.
18.5.2020
Bei schönstem Wetter mit Tempo zu den Störchen. Und heute das erste Mal eine Chance am Nest No. 2 die Kleinen zu sehen. fotografieren. Der Kleine streckt sich und wirft einen Kopf in den Nacken. Um zu klappern, wie die Großen. Nur klingt es noch nicht so laut. Vater Storch (er ist es wirklich, denn erträgt keinen Ring) beugt sich zärtlich herunter, säubert das Nest und sorgt für Gemütlichkeit.- Im Nest No. 1 steht die Störchin und bewacht ihre großen Kleinen. Für einen Moment legt sie sich noch einmal müde dazu. Aber es scheint nicht mehr ausreichend Platz, denn bald steht sie wieder auf. Im Baumnest ruhiges Küken-Warmhalten und einmal Wachwechsel mit freundlichem Geklapper.

19.5. und 20.5.2020
Gestern kam ich an das Nest No. 1 und sehe… gar nichts! Was ist los? Nach und nach erscheinen die Jungen aus der Tiefe des Nestes, aber kein Elternteil. Lange warte ich und schließlich kommt ein Storch geflogen. Also waren sie tatsächlich allein Zuhause, sind auf dem Nestrand balanciert ohne Ermahnung und haben sogar schon erste Übungen mit den Flügeln gemacht. Ich bin erleichtert, dass der Behüter wieder da ist!
Heute stehen alle vier Störche, ein großer und drei kleine aufrecht im Nest und gucken bei wunderbarem Abendlicht ganz gelassen und ruhig in die Landschaft. Die Kleinen habe schon ein glattes Federkleid und sind auf dem besten Weg „richtige“ Störche zu werden.

Die drei großen Kleinen aus Nest No. 1
Im Baumnest herrschen noch die Tätigkeiten der kleinen Kinderstube vor, Füttern und Wärmen und sich nicht sehen lassen. Im Nest No. 2 dagegen wird es langsam lebhafter. Die Küken werfen ihre Köpfe in den Nacken und klappern mit den kleinen Schnäbeln. Der Storch kümmert sich liebevoll.
22.5.2020
Heute unter erschwerten Bedingungen bei Sprühregen „endlich“ wieder rüber in den Hervester Bruch. Alle drei Damen treu auf ihren Nestern. Alle den schweren Schnabel auf die Brust gesunken widerstehen sie stoisch dem Wetter. Alle Jungen versteckt in die Nester gedrückt, sogar die drei Großen aus Nest No. 1. Nur nach einiger Zeit eine kleine Fütterung im Baumnest, etwas Bewegung im Nest No. 1. Morgen mehr, heute schnell nach Hause.

Stoisch widersteht die Familie auch Wind und Regen.
25.5.2020
Bei Storchens auch nicht viel Aufregendes, außer im Nest No. 1, wo die Jungen wieder alleine ausharren müssen, mal unsichtbar tief unten im Nest, mal fast wie die Ausgewachsenen im Nest stehend und Ausschau haltend. Lange warte ich, aber kein Elternteil kommt und ich fahre mit leichter Sorge wieder ab.
26.5.2020
Von den Störchen gibt es heute nur wenig Neues zu berichten. In herrlichem Sonnenschein und warmer Luft radeln wir zu zweit rüber. Nach meinem Eindruck können die beiden Jungen im Nest No. 2 am besten betteln, schnappen immer wieder nach Papas Schnabel. Im Nest No. 1 übt sich schon einer im Flügelschlagen. Die Storchmutter lässt ihre Jungen heute nicht so lange alleine. Manchmal stehen die Jungen hochaufgerichtet, wie kleine Statuen und weiße Keulen im Nest und schauen in die Landschaft. Entspannte Ruhe!
29.5.2020
Heute endlich wieder ein Storchbericht, aber ich muss mir mal langsam eine Exit-Strategie überlegen. Oder ich schreibe jeweils nur eine besondere Beobachtung. Heute: Die Großen aus Nest No. 1 sind jetzt „stubenrein“. Jedenfalls tritt einer von ihnen sorgfältig rückwärts an den Nestrand und schießt ein Geschäft heraus. Sogar ohne Anstoß eines Erwachsenen, ganz aus eigenem Antrieb.
2.6.2020
Dienstag bei schönstem Sonnenschein und guter Wärme zu zweit zu den Störchen. Im Nest No. 1 stehen drei schon recht große Jungstörche alleine und mit vor Hitze leicht geöffneten Schnäbeln und schauen in die Landschaft. Hungrig und unruhig – wo bleiben Mutter oder Vater mit Futter? Oder entspannt und gelassen? Wir wissen es nicht, aber auf der Außenrunde sehen wir tatsächlich einen Storch eifrig sammelnd und können ganz beruhigt sein.

Alle vier Storche aus Nest No. 1 schauen in die Landschaft.
4.6.2020
Heute dagegen fahre ich wieder alleine, kalt und nass! Im Nest No. 2 rücken die beiden Störchlein dicht zusammen, um sich zu wärmen. Eins dreht sich zum anderen, als ob sie sich Mut zuflüstern: „Mama kommt wieder und bringt etwas mit.“ Weiter geradelt.

„Mama kommt bald wieder!“
Heute stielt einmal das Baumnest dem Nest No. 1 die Show, denn endlich guckt ein Köpfchen heraus. Schon größer, als gedacht schnäbelt der Kleine temperamentvoll herum und Mana Storch steht stolz und gelassen daneben. Auch beim langen Beobachten, sieht man immer nur eines. Bin gespannt, ob es dabei bleibt. Vor lauter dort-hin-gucken zwei Wechsel im Nest No. 1 verpasst. Nun sind es also sicher 12 Störche und vielleicht noch mehr.
7.6.2020
Bei grauem und windigem Wetter heute wieder ein Besuch im Hervester Bruch. Im Nest No. 2 wacht Vater Storch über die beiden im Nest eingekuschelten Störchlein, im Nest No. 1 dagegen stehen die großen drei gemeinsam mit ihrer Mutter entspannt im Nest. Man kann sie fast nur noch an der grauen Färbung von Schnabel und Beinen unterscheiden. Im Baumnest wird das kleine Junge liebevoll von Mama beschnäbelt. Sie unternimmt auch einmal einen kleinen Ausflug in die Nähe und beguckt sich kritisch den dort stehenden Graureiher. Schnell ist sie wieder da, um ihr Störchlein zu schützen.
Ich muss wirklich mal zu einer anderen Tageszeit beobachten, um vielleicht mehr Aktivitäten zu sehen.

Mutter und Junge sind kaum noch zu unterscheiden in Nest No. 1
9.6.2020
Da stehen die drei fast erwachsenen im Nest No. 1 und ich denke darüber nach, wie schnell es ging von den kleinen, hilflosen Wesen mit wackelnden Köpfen bis zu diesen ansehnlichen Jungvögeln fast schon bereit für die ersten Flugübungen. Bei Menschen dauert das fast 18 Jahre!
Im Baumnest heute nichts zu sehen, außer der wachsamen Störchin – schon lange keinen zweiten dort mehr beobachtet.
10.6.2020
Heute kein Storchbericht.
14.6.2020
Ein Storchbericht vom Morgen. Tatsächlich war diesen Morgen viel mehr los bei Storchens und eine Überraschung gab es auch. Aber von vorne: Im Nest No. 2 sehe ich schon von weitem den Storch stehen, aber erst als ich das Fernrohr nehme, erkenne ich, dass es einer der Jungstörche ist. So sehr sind sie schon in den wenigen Tagen gewachsen, seit ich nicht mehr hier war. Der zweite liegt noch eingekuschelt und kriegt gelegentlich von seinem Geschwisterstorch etwas geflüstert: Zweites Frühstück kommt bald!“ Aber so lange kann ich nicht mehr warten, denn plötzlich kommt mir der Gedanke, ob ich vielleicht die Erstlingsflüge aus dem Nest No. 1 verpasst habe. – Aber nein, da stehen und sitzen sie noch alle drei vereint mit ihrer Mutter. Einer guckt sehr interessiert über den Nestrand und schlägt ein wenig mit den Flügeln. Sonst passiert nichts. Aber da, da kommt Vater Storch angesegelt und landet…. eine Etage tiefer, unterhalb des Nestes bei den dort angebrachten Vogelhäuschen. Ist es ihm oben zu eng? Wurde er ´rausgeworfen? Er stakst ein wenig zwischen den Balken herum, guckt in ein Vogelhäuschen – will er räubern? – und fliegt wieder ab. Kurz darauf erscheint er wieder mit einem Zweig im Schnabel und das wiederholt sich jetzt. Sehr erstaunlich und Anlass zu vielen Fragen: Störche haben doch nur ein Gelege im Jahr? Baut er schon für nächstes Jahr? Oder baut er sich einen Schlafplatz, um in der Nähe einer Familie zu sein?
Im Baumnest wartet das Nesthäkchen darauf, dass die durch die Wiese schreitende Mama mit dem Frühstück kommt. „Häkchen“ kann man hier durchaus bildlich verstehen, denn Hals und Kopf ragen tatsächlich wie ein weißer Haken aus dem Nest. -Und nebenbei streiten sich zwei Graureiher in der Wiese um den besten Platz auf Beute zu lauern. Volles Leben am frühen Morgen!

Vater Storch baut die untere Etage aus.

Das Nesthäkchen im Baumnest
19.6.2020
Gestern endlich mal wieder zu den Störchen und gestern habe ich die große Beringungsaktion verpasst. Nun sind sie also alle sechs beringt, nummeriert, registriert und in die offizielle Beobachtung genommen. Ist jetzt ein wenig privat-geheimnisvolles verloren? Ach nein, ich vergesse das einfach…. Sie haben ja auch Namen bekommen, die ich mal nachliefern muss. Ein netter Mann, den ich schon öfter hier gesehen habe, fachsimpelt mit mir ein bisschen und verspricht sogar, Fotos von der Beringung per E-Mail zu schicken. Ein anderes Paar ruft mir, als ich vorbei fahre, zu: „Oh, heute anders herum?“ dann grüße ich den ehemaligen Chef unseres Dorstener Hotels, der hier jeden Abend mit Frau und Hund entlang spaziert. Auch mit einem jüngeren Mann, der einen sehr in sich gekehrten Eindruck macht, wechsele ich ein paar Worte. Er beobachtet hier schon seit neun Jahren die Veränderung der Landschaft und das Vogelleben. Schließlich kann ich ihm doch noch ein Lächeln entlocken. So gibt es hier eine lockere Verbindung von vielen Menschen.
Ach und die Störche? Alle Jungvögel stehen oder liegen in ihren Nestern, putzen sich, warten auf Futter und einer breitet ab und zu seine Flügel aus und schlägt ein bisschen auf und ab. Wir sind alle gespannt, wann es ernst wird. Im Gras stolziert eine Mama und bemüht sich um Futter.
22.6.2020
Im Abendlicht sitzt in der Nähe des Nestes No. 2 Mutter Storch im Baum und genießt offensichtlich den freien Blick über die Landschaft in den Sonnenuntergang. Sie schüttelt ihr Brustgefieder und steckt schon einmal ihren Kopf ins Gefieder.
Ihre beiden Jungen stehen und sitzen im Nest – alles in Ordnung.
Aber im Nest No. 1 nur zwei Jungstörche! Ob der einen schon eingekuschelt liegt? Eine Etage tiefer steht ein Storch auf dem angefangenen Nest. Und bei genauem Hinsehen, erkenne ich: Es ist der dritte Jungstorch. Offensichtlich hat er einen Flugversuch hinter ich und ist nicht wieder ganz hoch gekommen. Er tut mir ein wenig leid so alleine. Ob er nun noch Futter bekommt oder die Nacht hungern muss? Jedenfalls stakst Mutter Storch fast hektisch durch die Wiese, immer hinter und zwischen den Heckrindern herum und schnappt nach Häppchen. Sie hört gar nicht auf und bis ich fahre bleibt sie unten.

Vater Storch macht das Nest für seine flüggen Jungen besonders gemütlich.
28.6.2020
Heute bei angenehmen Temperaturen und einem erfrischenden, leicht böigem Wind radle ich rüber zu den Störchen. Am Nest No. 2 viel los! Ein Elternteil bringt frisches Futter, auf das sich die Jungstörche wild stürzen. Ein großes Federgewirr und Gezappel! Schnell ist der alte Storch wieder weg und es dauert nicht lang und eine neue Lieferung kommt. In großer Höhe kreist die Storchmama und guckt, ob alles in Ordnung ist. Herrliches Segelwetter, das sie dort oben genießen kann! Und das muss wohl auch ein Jungstorch fühlen, denn er fängt an seine Flügel zu trainieren. Schließlich springt er dabei hoch in die Luft, landet aber immer auf der gleichen Stelle. Es sieht fast aus wie Trampolinspringen, so hoch kommt er, bestimmt einen Meter! Noch reicht es aber nicht, um aus dem Nest und vor allen Dingen auch zurück zu kommen. – Im Nest No. 1 stehen zwei Jungstörche. Der dritte schreitet mit Papa durch die Wiesen und sucht Futter. Plötzlich kreist er elegant einmal um das Nest und landet wie ein Alter! Alle drei wieder vereint. Im Baumnest sitzt Mama und betrachtet ihr Nesthäkchen, das noch ein wenig braucht, bevor das Flugtraining beginnen kann.







8.7.2020
Heute bei grauem Himmel und gelegentlichen Tropfen mittags endlich mal wieder zu den Störchen! Im Nest No. 2 stehen beide Jungstörche. Ob sie schon fliegen können? Neulich habe ich doch schon das heftige Training gesehen? Weiter zum Nest No. 1. Leer… auf den ersten Eindruck traurig, aber da sehe ich weiter hinten vier Störche im abgemähten Feld. Hinten herum schleiche ich mich an und da sehe ich die drei Jungstörche mit ihrer Mutter. Sie beobachtet mich kritisch und scheint Wache zu halten, während die Jungen im Gänsemarsch oder eher im Storchenmarsch durch das Feld staksen. Später beobachtet die Mutter ihre Fast-Erwachsenen auf einem Pfosten stehend. Beruhigend, dass sie noch nicht ganz auf sich gestellt sind. Im Baumnest steht der Jungvogel noch wie festgenagelt und allein. Noch ein bisschen Zeit braucht es. Auf dem Rückweg sehe ich großes Flügelschlagen am Nest No. 2 und dann erhebt sich einer der Störche, fliegt noch etwas ungelenk einen großen Bogen um das Nest. Der andere läuft aufgeregt im Nest nach rechts und links, wo sein Bruder gerade fliegt, kann aber offensichtlich noch nicht mitfliegen. Spannend zu sehen, wie sie sich langsam alle die Welt erobern!


Nesthäkchen allein Zuhause im Baumnest
21.7.2020
Jetzt endlich mal wieder nachsehen, was inzwischen bei den Störchen passiert ist. Ob wohl alle Nester schon leer sind? Nein! Im Nest No. 2 stehen zwei Jungstörche und da kommt doch tatsächlich der Storchpapa vorbei und hat noch etwas zum Fressen mitgebracht. Gierig stürzen die beiden sich darauf. Aber einer konnte schon fliegen, bevor ich im Urlaub war! Sind sie zwei faule Nesthocker, die sich bedienen lassen und nicht selbstständig werden wollen? Sie waren schon als Kleinstorche immer besonders gierig. Papa fliegt auch gleich wieder ab. Verkniffene Pflichterfüllung für zwei Faulpelze. Das Nest No. 1 ist tatsächlich leer, aber da segelt ein einziger Jungstorch ein und guckt lange in der Landschaft herum. Wo sind die Geschwister? Er zupft ein bisschen im Nest herum, nimmt ein kleines Bündel Hälmchen, wirft es wieder ins Nest, nimmt es wieder, wirft es wieder ins Nest… langweilig allein! Wann komme sie denn? Im Baumnest steht das Nesthäkchen und will auch endlich groß sein. Einmal Flügel ausbreiten…. Es dauert noch.
24.7.2020
Endlich die zwei Jungstörche aus dem Nest No. 2 haben sich überwunden und stehen beide dicht beieinander am See-Rand. Jetzt heißt es selber Futter suchen! Keine Nest-Vollversorgung mehr. Nest No. 1 ist leer, ein wenig melancholischer Moment, aber im Baumnest steht das Nesthäkchen noch. Hoffentlich lernt es schnell genug fliegen, um mit den anderen nach Süden zu reisen.
26.7.2020
Zwei leere Nester, ein melancholisches Gefühl und auch das Nesthäkchen im Baumnest tröstet mich nicht richtig, denn es sitzt dort so alleine… 1,2,3 im Sauseschritt, rennt die Zeit, wir müssen mit….
Aber auf dem Rückweg große Show am See-Rand: Sechs große Störche staksen durch den Sumpf und suchen nach Futter, ab und zu ein kleines Gerangel mit Flügelschlagen…Schließlich kommt noch ein siebter angesegelt. Ich kann die Alten und die Jungvögel kaum noch unterscheiden. Schließlich schwingt sich ein Jungvogel auf ins Nest No. 2 und klappert für sich alleine: „Zuhause, satt und schlafbereit!“ Da kommt auch schon der nächste, der Storchenpapa und dann auch noch der zweite Jungvogel. Der elegante Bogen beim Landeanflug klappt schon fast, aber der Schwung ist doch noch zu groß und so schubst es den Storchenvater auf der anderen Seite wieder aus dem Nest. Großes Gelächter auf dem Beobachtungsstand! Da ist es wieder, das volle Leben!
27.7.2020
Ein schöner, lauer Sommerabend und die Geschwister aus Nest No. 2 staken entspannt durch den Sumpf am See, ohne sehr nach Futter zu stochern. Da kommt Mamastorch und es sieht ganz danach aus, als würde sie Ihnen noch Futter hervorwürgen. Kann das sein? Sich so bedienen zu lassen? Nesthäkchen im Baumnest hat heute wenigstens einen Jungstorch-Nachbarn im Nest No. 1 zur Gesellschaft, sehr beruhigend!
31.7.2020
In der Morgenfrische noch ohne Frühstück schnell mal nachsehen, was bei Storchens s los ist. Der See bei Nest Nr. 2 ist schon sehr geschrumpft und durch den Matsch staken zwei Jungstörche mit der Storchmama, erkennbar an ihrem Ring. Sie stakst hektisch durch die Matsche und sticht bei jedem Schritt mit dem Schnabel zu und da, da erwischt sie tatsächlich einen Fisch und frisst ihn selber. Die Halbstarken müssen für sich selber sorgen! Oben im Nest kuschelt noch einer, ob es Pa´ ist, der die Zeit ausnutzt, wenn alle ausgeflogen sind? – Gähnende Leere im Nest No. 1und auch im Baumnest kein Nesthäkchen mehr zu sehen. Nun ist es wohl auch flügge, zum Glück!
7.8.2020
Heute ein Kein-Storchbericht: Ganz früh morgens bei Sonnenaufgang mal schnellnachsehen, ob noch jemand im Nest schläft. Nein, kein einziger Storch zu sehen, auch nicht am See, auch nicht in den Feldern und Wiesen am kleinen Umweg.
20.8.2020
Heute bin ich endlich mal wieder rüber geradelt und kann aber nur wieder einen „Kein-Storch-Bericht“ schreiben. Keiner zu sehen, nicht bei den Nestern, nicht am fast ausgetrockneten See, nicht am Wasserbüffel-Sumpf und auch nicht bei den Heckrindern. Ob sie wohl schon abgeflogen sind?
30.8.2020
Bei halbsonnigem Spätsommerwetter ein besonderes Storchenglück zum Abschied: Heute habe ich einen kleinen Schlenker auf meiner Radtour gemacht, um zu sehen, ob es noch Brombeeren gibt und da treffe ich einen der häufigen Beobachter, der mich sofort auffordert hoch in den Himmel zu sehen. Dort fliegen sie, bestimmt mehr als 30 Störche, im ruhigen Gleitflug kommen sie von Nordwest und kreisen in einem Aufwind über dem Hervester Bruch. So ein majestätischer, ruhiger Flug im ungeordneten Schwarm, immer mal wieder wechselt einer den Platz, setzt sich etwas ab und kehrt wieder zum Schwarm zurück, alles wie in Zeitlupe.
Schließlich nehmen sie den Flug nach Südwesten auf und entgleiten unseren Blicken auf die lange Reise über Frankreich, Spanien, Gibraltar bis nach Afrika. Auf Wiedersehen bis zum nächsten Jahr!

Gen Süden! Foto: Jan Hein van Steenis
Ina Bernds, EGLV, Meisterin Gewässer Westliche Lippe
Interview
Frau Berns, bitte stellen Sie sich und Ihre Arbeit vor. Was sind Ihre Aufgaben im bei EGLV/ Lippeverband und insbesondere am Rückläufigen Hambach?
Ich bin ursprünglich Technikerin im Garten- und Landschaftsbau und bin bei EGLV, also Emschergenossenschaft/Lippeverband, als Flussmeisterin angestellt, auch als Strecken- oder Gewässermeisterin bezeichnet. Meine Hauptaufgaben sind der Hochwasserschutz und die Gewässerunterhaltung an diversen Gewässern: am Lippehauptlauf von Wesel bis Marl, das sind etwa 40 km, an großen Nebenlaufgebieten, sowie an zwei Bachlaufgebieten, die direkt in den Rhein münden.
Speziell am Rückläufigen Hambach sind meine Aufgaben ein wenig anders als an allen anderen Gewässern, da wir uns den Bereich mit der Stadt Dorsten aufgabentechnisch teilen. Ich bin für die Gewässerunterhaltung des rückläufigen Hambachs zuständig und für die Gehölzpflege in seinem Umfeld. Die Stadt Dorsten wiederum macht die Grünpflege und die Wegeunterhaltung sowie auch das Müllmanagement, also sprich das Aufstellen von Mülleimern und deren Leerung.
„Rückläufiger Hambach“, das ist ein merkwürdiger Name. Was hat es damit auf sich?
Der Hambach hat heute wieder seinen ursprünglichen Verlauf. Etwa Mitte der Fünfzigerjahre musste der Lauf infolge von Bergsenkungen verlegt werden und zwar an die Stelle, wo jetzt der Rückläufige Hambach verläuft. Aufgrund dieser Bergsenkungen hatte man keine Vorflut mehr zur Lippe. D.h. in diesem Teil, den wir jetzt als Rückläufigen Hambach kennen, floss zwischen Mitte der Fünfziger- und Mitte der Neunzigerjahre der Hambach in Richtung Lippe und wurde über ein Pumpwerk in die Lippe gehoben.
Mitte der Neunzigerjahre kam es erneut zu Bergsenkungen und der Hambach wurde wieder in sein ursprüngliches Bett und zu einem neuen Pumpwerk verlegt, welches aktuell den Hambach in die Lippe hebt. Das aufgegebene Bett des Baches wurde in Kooperation mit der Stadt Dorsten als Park ausgebaut. Allerdings mit einer anderen Fließrichtung, nämlich wieder Richtung blauen See, wo es nun auf den Hambachhauptlauf trifft. Man nutzt hier einen guten technischen Kniff. Wir zweigen ein ohnehin gepumptes Wasser des Hambachs ab und lassen es noch mal in einer Schleife zurücklaufen zum Blauen See. Dort trifft es wieder auf den Hauptlauf und somit ist immer ein bisschen Wasser im Kreis unterwegs. Mit dem großen Vorteil, dass man einen Teil des Bachlaufs erhalten konnte, der sonst nicht mehr existieren würde.
Welche besonderen Aspekte gibt es bei der Arbeit an einem solchen, gepumpten Bach zu berücksichtigen? Hochwasserschutz ist generell bei Ihrer Arbeit sehr wichtig, das haben Sie betont, insbesondere in Zeiten des Klimawandels und der Extrem-Wetterereignisse. Wie wichtig ist aber auch der Natur- und Artenschutz und wie können Sie diese beiden Aspekte Ihrer Arbeit zusammenbringen?
Speziell am Rückläufigen Hambach ist der Hochwasserschutz nicht unmittelbar meine Aufgabe, sondern mittelbar. Da der komplette Hambach in die Lippe gehoben wird, liegt der größte Teil des Hochwasserschutzes in den Händen meiner Kollegen der Pumpwerkstruppe, indem die dieses Pumpwerk vierundzwanzig Stunden an sieben Tage in der Woche betreiben. Ein Ausfall des Pumpwerks würde Hochwasser verursachen. Insofern ist dies der wichtigste Hochwasserschutz am Hambach, dass dieses Pumpwerk immer in Betrieb ist. Würde es ausfallen, hätte dies natürlich auch Folgen für den Rückläufigen Hambach, den wir allerdings schnell absperren können, sodass kein Wasser mehr hindurchfließen könnte.
Am Rückläufigen Hambach ist eher relevant, dass wir eine ganz geringe Gefällestrecke haben. Wir müssen hin und wieder den kompletten Bach ausmähen, damit immer Wasserfläche erhalten bleibt. Der Bach würde ansonsten durch den Pflanzenwuchs verlanden und irgendwann wären die Durchlässe nicht mehr durchgängig. Der Bachlauf ist in diesem Teil als ein künstliches Gebilde zu betrachten, das wir am Laufen halten müssen, so technisch wie nötig, aber mit so wenig Natureingriff wie möglich. Das ist an dieser Stelle unsere Devise und deswegen sieht es auch manchmal ein bisschen wild aus. Oft nicht so geordnet im menschlichen Sinne, weil wir dem Natur- und Artenschutz Raum geben wollen. Die Natur kennt unsere menschliche Ordnungsvorstellung von einer gepflegten Grünanlage nicht und das ist auch gut so. Das muss man als Mensch ertragen können.
Ein praktisches Beispiel ihrer Arbeit wäre also das Ausmähen. Heißt das, dass Sie den Schilfartigen Bewuchs, den man überall am Bauchlauf sieht, jedes Jahr zurückschneiden? Kommen mitunter auch Bagger zum Einsatz, wenn Sie feststellen, der Bachlauf droht zu versanden und zu verlanden?
Versanden ist eher kein Problem. Verlanden durch den Aufwuchs des Schilfes ist ein Problem. Wenn möglich machen wir das Ausmähen nicht in jedem Jahr, das kommt auf das Wachstum der Pflanzen an. Maximal würden wir es einmal im Jahr machen müssen. Es kann aber schon mal sein, dass wir in sehr trockenen Jahren wie beispielsweise 2022 einmal aussetzen können mit der Arbeit. Das müssen wir immer von Fall zu Fall entscheiden. Tatsächlich mähen wir mit einem Bagger, der eine Mähvorrichtung am Arm hat. Das ist ein Schneidwerk, mit dem man die Pflanzen sofort aufnehmen kann. Richtiges baggern in der Gewässersohle können wir so vermeiden.
Dies passiert wahrscheinlich im Herbst?
Ja, auf jeden Fall in der Schonzeit, zwischen Oktober und Ende Februar. Wir achten dabei auf die Wetterlagen und arbeiten am liebsten, wenn es frostig ist, weil wir dann weniger kaputtfahren.
Kommen wir noch einmal auf den Aspekt Ordnung, also im Sinne von menschlichem Ordnungssinn, zu sprechen. Die Natur hat andere Prioritäten und sicher kommen Menschen auf sie zu, die dazu Fragen haben. Werden Sie darauf oft angesprochen?
Wir müssen uns durchaus häufig erklären. Wenn wir freundlich angefragt werden, ist das überhaupt kein Problem für mich und meine Mitarbeiter vor Ort. Wir unterhalten uns gerne mit den Leuten und beantworten ihre Fragen. Wie gesagt, es kommt immer drauf an, wie die Fragestellung ist, wie freundlich die Ansprache, so wie überall. Aber ja, na klar, die Fragen zur Ordnung kommen auf. Aber wir haben auch keine Probleme dies zu erklären und die meisten Leute reagieren positiv. Außerdem versuchen wir Kompromisse zu finden. Im Wegebereich beispielsweise ist eine intensivere Pflege nötig, damit niemand vom Fahrrad fallen kann. Und die Verkehrssicherheit wird in jedem Fall über alles andere gestellt. Aber dafür müssen die Menschen dann hinnehmen, dass es in dem Bereich des Bachlaufs und dahinter ziemlich wild aussieht. Wir können beides gut miteinander in Einklang bringen.
Welche Arbeiten machen Ihnen besonders Freude am Hambach? Oder gibt es ein besonderes Erlebnis, an das Sie sich gern erinnern?
Früher, bevor ich die Meisterstelle übernommen habe, habe ich selbst mit an den Bächen vor Ort gearbeitet. Ich muss sagen, unterjährig gibt es so viele verschiedene Aufgaben, dass man keine besonders herausstellen kann. Viel Spaß macht immer Teamarbeit. Oder wenn wir zum Beispiel ein Gehölz fällen müssen, weil es die Verkehrssicherheit gefährdet und wir können aber den Stamm erhalten, vielleicht irgendwo in der Fläche einbauen, so dass wieder ein Habitat für gewisse Arten geschaffen wird. So etwas macht besonders Spaß. Weil man gleichzeitig, obwohl man einen Baum entnehmen muss, an anderer Stelle Gutes für die Natur tun kann.
Im Herbst 2025 kommt die Installation LEBENLASSEN! an den Bachlauf, die den Verlust der Biodiversität und auch insbesondere das massive Insektensterben thematisiert. Wie stehen Sie zu dem Problem? Und wie stehen Sie zu dem Kunstwerk?
Das Insektensterben ist massiv, aber aus meiner Sicht, und damit meine ich nicht nur EGLV, schwenken wir wieder in die richtige Richtung ein. Kleinschrittig, aber mein persönliches Empfinden ist schon, dass es wieder mehr Insekten gibt. Bei weitem nicht genug, da müsste man allerdings die Fachleute fragen, die die Entwicklung monitoren. Aber es gibt aus meiner Sicht eine Erholung und wir arbeiten als EGLV daran mit, durch Anpassung von Bearbeitungszeitpunkten oder Rückzug aus bestimmten Bereichen Lebensraum zur Verfügung zu stellen.
Ich bin kein künstlerisch bewanderter Mensch, aber ich freue mich über dieses Kunstwerk, weil es einen guten, praktischen Bezug bietet. Weil es hoffentlich vielen Menschen einen Anstoß gibt, sich um das Problem des Insektensterbens mit zu kümmern. Aus meiner Sicht kann jeder etwas tun. Mir gefällt auch der Standort des Kunstwerkes gut. Es steht in direkter Nachbarschaft zur Neuen Schule Dorsten, wo ich mir erhoffe, dass die eine oder andere Lehrkraft und die Rektorin das Thema aufgreifen. Von den Kindern können auch die Eltern lernen. Diesen Gedanken finde ich sehr schön. Mir gefällt auch die Gestaltung der Installation, weil sie sehr bildlich-anschaulich und nicht abstrakt ist. Man versteht die Arbeit ohne weitere Erklärung.
Aus Ihren Worten höre ich, dass sie trotz allem hinsichtlich des Artenschutzes optimistisch gestimmt sind. Sie verzweifeln nicht an der Größe der Aufgabe, wenn sie an Klimawandel und Artensterben denken, sondern Sie sehen eher die Chance in der Arbeit vor Ort das Richtige zu tun und Ihren Beitrag zu leisten?
Genau. Verzweiflung kommt nicht auf und wäre in meinen Augen eher eine Bremse. Tatsächlich sind Klimawandel und Extremwetter etwas, das mich und den EGLV insgesamt, nicht unbedingt am Hambach aber an vielen anderen Gewässern, extrem beschäftigt. Darauf müssen wir uns einstellen und uns damit, ebenso wie mit dem Artensterben, auseinandersetzen. Und jeder einzelne Mensch muss das auch. Aber ich sehe ebenso viele Chancen, wenn viele Akteure zusammenwirken, im Kleinen wie im Großen. Sicherlich hat der EGLV Möglichkeiten im größeren Stil Aufgaben zu übernehmen. Aber viele kleine Maßnahmen können genauso wirksam sein. Ich bin der Auffassung jeder Bürger, jeder Erwachsene, jedes Kind hat eine Chance zu helfen und an dieser Aufgabe mitzuwirken. Ich sehe das eher positiv.
Sie meinen, jeder, der einen Garten hat, kann Insektenschutz betreiben oder sich im Außenraum an Gewässern oder in Grünstreifen entsprechend verhalten?
Ja, absolut. Jeder, der einen Garten oder Balkon hat, selbst Leute, die keinen eigenen Garten oder Balkon haben, die sich vielleicht um eine kleine Bauminsel kümmern, können etwas beitragen. Jeder kann zum Beispiel ein bisschen Wasser zur Verfügung stellen. Ich meine ausdrücklich keinen Pool, sondern einen Teich oder eine Tränke. Weil Insekten für ihren Vermehrungszyklus oftmals auf Wasser angewiesen sind, kann das sehr hilfreich sein. Und ansonsten kann man sich sicherlich auch im Stadtgebiet sehr nützlich machen, zum Beispiel einfach über Rücksichtnahme. Keinen Müll hinterlassen, den Müll vielleicht mal 500 m zum nächsten Mülleimer oder nach Hause mitnehmen. Die Entsorgungsmöglichkeiten gerade in Dorsten sind sehr gut. Vielleicht auch noch ein bisschen hinter dem eigenen Hund her sei und die Hinterlassenschaft aufheben, auch da sind die Möglichkeiten in Dorsten super gut. Das wäre auch wertschätzend gegenüber allen Leuten, die in diesen Anlagen arbeiten.
Der Rückläufige Hambach in seiner jetzigen Form ist in den Neunzigern des 20. Jahrhunderts geschaffen worden. In der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts hat sich die Gegend somit stark durch die Bergsenkungen und die baulichen Maßnahmen in der Folge verändert. Rechnen Sie damit, dass der jetzige Zustand erhalten bleibt oder wird sich der Grünzug mit dem Rückläufigen Hambach zukünftig noch einmal stark verändern?
Ob es noch einmal Projekte für diesen rückläufigen Hambachabschnitt geben wird, kann ich jetzt noch nicht absehen. Es ist ein schmaler Park, der aufgrund seiner Größe nicht so viel Entwicklungsspielraum zulässt. Allerdings muss man sagen, wir haben etwa vier Hektar Fläche, die durch das Gewässer und den Pflanzenbewuchs eine gewisse Kühlung erfährt. Da haben wir als Zwischenziel schon eine recht gute Sache geschaffen. Aber natürlich werden bei EGLV sämtliche Gewässer auch im Sinne der Wasserrahmenrichtlinie immer wieder neu betrachtet. Und soweit sich Möglichkeiten ergeben, Verbesserung durchführen zu können, werden die auch durchgeführt. Selbstverständlich gibt es Priorisierungen. Dass Gute an dem Gewässer Rückläufiger Hambach ist, dass e nicht trockenfallen kann, weil vom Hauptlauf Hambach Wasser abgezweigt wird und dieses Gewässer durchfließt. Der Hambach selbst ist nicht von Trockenheit betroffen. Er hat ein riesiges Einzugsgebiet bis hoch nach Reken und hat, was Trockenheit angeht, wirklich gar keine Probleme. Im Bereich des Rückläufigen Hambachs wird es bei Hitze durch das Gewässer und die Pflanzen immer etwas kühler sein, als in den Bereichen ohne Baumbestand und Wasserverdunstung und deshalb werden Menschen und Tiere in diesem Park immer eine gewisse Abkühlung finden.
Georg Tenger
Erhalt von heimischen Streuobstwiesen
Streuobstwiesen sind vom Menschen geschaffene Biotope und gehören seit Jahrhunderten zu unserer Kulturlandschaft. Schon seit der Römerzeit wird in Deutschland systematisch Obst angebaut. Die größte Ausdehnung des Obstanbaus auf Streuobstwiesen wurde in Deutschland um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert erreicht. Als Streuobstwiesen werden alters- und sortendiverse Ansammlungen von hochstämmigen Obstbäumen, deren Flächen meist zusätzlich als extensive Wiesen oder Weiden genutzt werden, bezeichnet. Die Bäume stehen so weit auseinander, dass jeder Baum ausreichend Platz und Licht zum Wachsen hat. Die Krone dieser Bäume beginnt erst auf einer Höhe von ca. 180 Zentimetern. Die Nutzung von Streuobstwiesen findet somit in der Regel in zwei Stockwerken statt. Im oberen Stockwerk, der Baumkrone werden die Früchte geerntet, im unteren Stockwerk wird der Grasaufwuchs durch Mahd oder Beweidung genutzt.
Streuobstwiesen liefern uns Menschen somit hochwertiges, ungespritztes Obst von alten, regionaltypischen Apfel- und Birnensorten sowie von zahlreichen weiteren Obstsorten.
Nach dem Zweiten Weltkrieg ging die wirtschaftliche Bedeutung der Streuobstwiesen immer mehr zurück: Landwirtschaft und Obstbau wurden eigenständige Betriebszweige, der Obstbau konzentrierte sich auf intensiv gepflegte Niederstamm-Plantagen.
Bald wurde der Apfel zum EU-weit standardisierten Handelsprodukt. Die Sortenvielfalt ging dabei verloren und zahlreiche Streuobstwiesen wurden sogar mit EG-Prämien gerodet. Durch das preisgünstige Obstangebot auf dem Markt ließ das Interesse an der Selbstversorgung in der Bevölkerung stark nach, die Pflege der Altbestände wurde vernachlässigt und junge Bäume nicht mehr nachgepflanzt. So sind allein zwischen Mitte der sechziger Jahre und 2005 in Nordrhein-Westfalen drei Viertel aller Streuobstwiesen verloren gegangen und nehmen heute weniger als 0,5 % der Fläche von NRW ein.
Streuobstwiesen zählen jedoch zu den artenreichsten heimischen Lebensräumen und haben daher eine große Bedeutung für die biologische Vielfalt. Viele Tiere finden hier Nahrung und einen Lebensraum. Sie profitieren von der Blütenvielfalt der Wiesen ebenso wie von saisonalen Nahrungsspitzen während der Blüte und Fruchtreife der Bäume und Weiden. Faulendes Obst, Totholz und Dunghaufen tragen ebenfalls zur Artenvielfalt bei. Von Totholz und Höhlen in Altbäumen, aber auch von künstlichen Nisthilfen profitieren viele Arten: Vögel, Fledermäuse, Hornissen und andere Insekten. Typische höhlenbewohnende Vogelarten auf Streuobstwiesen sind Steinkauz, Star, Grünspecht, Kohl- und Blaumeise, aber auch seltenere Arten wie Feldsperling und Gartenrotschwanz. Auch Säugetiere wie Haselmaus, Gartenschläfer und Siebenschläfer nehmen Höhlen in alten Obstbäumen gerne an. Fledermäuse nutzen Obstwiesen als Jagdrevier und die Baumhöhlen als Unterschlupf. Je älter die Bäume, desto höher die Artenvielfalt. Es kommt also auf eine langjährige, gute Pflege, geeignete Schnittmaßnahmen und fachgerechte Neupflanzungen an.
Für den Artenreichtum der Streuobstwiesen ist die untere Nutzung in Form von extensiv gepflegten Wiesen und Weiden von besonderer Bedeutung. So lassen sich auf Streuobstwiesen mit extensiver Unternutzung etwa 5.000 Tier- und Pflanzenarten nachweisen, darunter mehrere hundert Insektenarten. Eine extensiv genutzte Wiese sollte erst nach dem Blühhöhepunkt zum ersten Mal geschnitten werden (Mitte Juni bis Mitte Juli), ein zweiter Schnitt sollte erst kurz vor der Obsternte im September erfolgen. Für blütenbesuchende Insekten ist es besonders günstig, wenn die Wiese in Abschnitten gemäht wird und jeweils ein Teil des Blütenangebotes erhalten bleibt. Das Mähen oder Beweiden ist aber auch für andere Bewohner wichtig, denn nur im niedrigen Gras findet der Steinkauz den Käfer und der Grünspecht seine Lieblingsspeise, die Ameisen.
Eingebettet in eine strukturreiche Agrarlandschaft mit Höfen, halboffenen Feldfluren, Wegen, Teichen, Alleen und Hecken wirken sich Streuobstwiesen besonders positiv auf den Artenreichtum aus. Es sind Lebensräume aus Menschenhand und behalten ihre Qualität und ihren Wert für Natur und Umwelt nur durch regelmäßige Pflege!
Die Spezialisierung in unserer Landwirtschaft lässt heute jedoch kaum Zeit für die Pflege und Bewirtschaftung der hofeigenen Obstwiesen. Deshalb sind von Landwirten angelegte und bewirtschaftete Streuobstwiesen selten geworden. Aber auch in unseren Gärten sind immer weniger Obstbäume zu finden. Unsere Gärten werden immer kleiner und das Interesse an Obstbäumen geringer. Obst wird in Plangagen angebaut und im Supermarkt gekauft. So leiden Artenvielfalt und Qualität! Obstbäume gehören jedoch zu den bienenfreundlichsten Pflanzen im Garten. Bienen tragen in erheblichem Maße zum Erhalt von Wild- und Kulturpflanzen und deren Erträge bei. Zudem zählen die Honigbienen zu den wichtigsten Bestäubern. Ohne Bienen keine Ernte!
Am besten schmecken Obst und Saft aus dem eigenen Garten. Aber nicht jeder verfügt über einen Garten, deshalb setzen sich viele Naturschutzeinrichtungen wie die Biologische Station Kreis Recklinghausen für den Erhalt von heimischen Streuobstwiesen ein. Die Biologische Station möchte die bestehenden Streuobstwiesen im Kreis Recklinghausen dauerhaft erhalten und erneuern. Mit ihrem jährlichen Apfelsafttag, bei dem eigene Äpfel und Äpfel aus den Schutzgebieten gepresst werden, möchte sie dazu beitragen, die eigenen Früchte zu verwerten und zu genießen. Mit ihren Bildungsangeboten möchte die Biologische Station Kreis Recklinghausen insbesondere unseren Kindern die Bedeutung der Streuobstwiesen für die Artenvielfalt vermitteln.
Hierdurch hoffen wir, einen kleinen Beitrag zum Erhalt unserer Streuobstwiesen mit ihren alten Obstsorten als artenreiche, nützliche und genussreiche Kulturbiotope zu leisten.
Horst Papenfuß und Michael Drescher
Wie die „Auerochsen“ nach Hervest zurück kamen
Wer durch die Wiesen und Felder im Hervester Bruch nördlich von Dorf-Hervest geht, wird sich wie in eine andere Zeit versetzt fühlen. Auf einer Fläche von etwa 25 ha weiden dort Rinder, die so aussehen, als seien sie gerade der Urzeit entsprungen: die Auerochsen von Hervest.
Was sind das für Tiere, die so gar nicht wie „gewöhnliche“ Kühe aussehen, wo kommen sie her und was machen sie gerade in Hervest? Dazu müssen wir zunächst zurück in die Geschichte schauen. Bis zum Ende der letzten Eiszeit vor etwa 18.000 Jahren war Mitteleuropa reich strukturiert, lichte Wälder wechselten mit Mooren an den nassen Bereichen, weite und offene Steppen prägten die Börden, an den Flüssen gediehen reiche Auenwälder.
So abwechslungsreich die Landschaft war, so artenreich war auch die Tierwelt, die in ihr lebte. So kamen neben zahlreichen Großtieren wie Waldelefant, Steppennashorn, Wildpferd, Flusspferd und Elch auch vier Wildrindarten vor: Europäischer Wasserbüffel, Steppenwisent, Waldwisent und Auerochse.
Indem der Mensch nach der letzten Eiszeit die Großtiere durch starke Bejagung und Lebensraumzerstörung immer mehr dezimierte und letztlich ausrottete, konnte sich der Wald ausbreiten.
Durch zunehmende Siedlungstätigkeit im Mittelalter (verstärkter Holzeinschlag) und Ausweitung der Landwirtschaft in der Neuzeit (Hutung) wich der geschlossene Wald mehr und mehr der typischen Heidelandschaft, wie sie auch für den Hervester Bereich in alten Quellen belegt ist.
Waldwisent überlebt – Auerochse stirbt aus
Waldwisent und Auerochse überlebten bis in die Neuzeit. Die letzten freilebenden Waldwisente wurden 1927 im Kaukasus getötet, jedoch gelang es aus den wenigen, in zoologischen Gärten gehaltenen Wisenten, eine stabile Population wieder aufzubauen.
Nicht so günstig verlief das Schicksal der Auerochsen.
Diese ehemals von Südskandinavien bis Nordafrika und im gemäßigten Asien verbreitete Art verschwand in Mittel- und Westeuropa zwischen 1200 und 1400 n.Chr., auch in Hervest.
Durch die Lebensraumzerstörung sowie die zunehmende Konkurrenz zu den Hausrindern, die nun ihrerseits in den Wäldern grasten, war ein gemeinsames Nebeneinander von Hausrind und Ur nicht mehr möglich. Der letzte Auerochse starb im 17. Jahrhundert in Polen.
Mit dem weltweiten Aussterben des Auerochsen ist das genetische Material der Art jedoch nicht erloschen. Die Experten sind sich heute weltweit einig, dass der Auerochse der Stammvater aller Hausrinder ist. Die Domestikation (Umbildung von Wildtieren zu Haustieren) begann spätestens 6000 v. Chr., und immer noch besteht ein wesentlicher Teil der genetischen Information des Auerochsen in verschiedenen Hausrinderrassen fort.
Geschichte der Heckrinder
Unabhängig voneinander kreuzten zu Beginn der 20er Jahre die Gebrüder Heck im Berliner und Münchener Zoo verschiedene primitive Rinderrassen miteinander, um den Auerochsen zurück zu züchten.
Die aus den Kreuzungen hervorgegangenen Rückzüchtungen, die nach ihren geistigen Vätern auch Heckrinder genannt werden, sehen dem Auerochsen zwar äußerlich schon sehr ähnlich, sind aber kleiner und zeigen noch einige Haustiermerkmale auf, Heckrinder sind eine robuste, pflegeleichte Rasse und besitzen eine hohe Resistenz gegen Krankheiten und können ganzjährig im Freien gehalten werden. Die Rinder verwerten auch rohfaserreiches Futter sowie Weidenzweige und Blätter, sogar Brennnesseln und Disteln verschmähen sie nicht. Kühe werden mit 15 Monaten geschlechtsreif und haben eine Tragzeit von 9 Monaten. Früher wurden Heckrinder nur in Zoos und Wildgattern gehalten. Vor einigen Jahren entdeckten Naturschützer die Tiere für die Bewirtschaftung und Pflege von Schutzgebieten mit offener und halboffener Vegetationsstruktur aufgrund der vorher genannten Kriterien. Dabei ist auch die Wehrhaftigkeit der Rinder, die zur Beruhigung der Flächen beiträgt, von Bedeutung.
Wie kamen die „Auerochsen“ nach Hervest zurück?
Die Geschichte begann eigentlich 1991 mit dem Bau der Umgehungsstraße L 608n von Altendorf nach Wulfen. Für diese Straße wurde eine Ausgleichsmaßnahme in der Lange Heide (östlich der Wenge) von ca. 25 ha geschaffen. Intensiv genutztes Grünland und Ackerflächen sollten sich zu einem sogenannten multifunktionellen Biotop entwickeln, mit mehreren Wasserflächen, Hecken, kleinen Waldflächen, Baumgruppen usw., was sich anfänglich auch wie gewünscht entwickelte. Es wurde auch zwischenzeitlich eine Schafbeweidung durchgeführt, wobei es aber wohl Probleme mit dem Schäfer gab, diese sind uns jedoch nicht näher bekannt.
Nach einigen Jahren jedoch begann das Gebiet unerwünschter Weise zu verbuschen, die angelegten Wasserflächen begannen zu verlanden und wuchsen mit Weiden und Erlen zu. Die Artenvielfalt von Fauna und Flora, die sich dort eingestellt hatte, drohte wieder zu verarmen.
Im Februar 1995 wurden in Gahlen Östrich vom NABU (Naturschutzbund) Dorsten, dessen Mitglieder wir sind, Kopfweiden geschnitten. Dort weideten im Winter Heckrinder in ihrem zotteligen Winterfell und trotzten der grimmigen Kälte. Sofort entstand eine große Sympathie für diese urigen, bis dahin auch für uns unbekannten Rinder.
Später am Tag kam man mit dem Besitzer der Tiere, Herr von der Warth aus Rhade, ins Gespräch. Er erzählte uns, wie er zu den Tieren gekommen war und dass er sie eigentlich „nur so zum Spaß“ halten würde. Er bat uns, die kleinen Äste und Zweige, die beim Schneiden der Kopfbäume angefallen waren, den Tieren doch einfach als willkommenes Futter zu geben, da sie diese gerade im Winter, wenn es kaum andere Nahrung gibt, gern fressen würden.
Sofort erwuchs daraus die Idee, mit diesen Rindern auch die Ausgleichsfläche im Hervester Bruch zu pflegen und die Weiden so zurückzudrängen.
Es mag ein Wink des Schicksals gewesen sein, dass auch Herr von der Warth sofort von der Idee begeistert war, suchte er doch händeringend eine geeignete Fläche, um die Herde zu vergrößern.
Da der damalige Zustand der Fläche sowie seine Entwicklungsperspektive äußerst unbefriedigend war, wurde im Namen des NABU Dorsten nach dem Besitzer der Ausgleichsfläche geforscht. Die Nachforschungen ergaben, dass die Flächen im Zuge des Neubaus der L 608n vom Landschaftsverband Westfalen Lippe aufgekauft worden waren und sich nun unter der Verwaltung des Westfälischen Straßenbauamtes in Bochum befinden.
Mit dem zuständigen Sachbearbeiter wurde geklärt, ob eine extensive Beweidung der Fläche mit Heckrindern möglich wäre.
Damit begann ein monatelanger Weg durch die Behörden und Institutionen, mit zahlreichen Anrufen beim Westfälischen Straßenbauamt in Bochum, der Unteren und Oberen Landschaftsbehörde in Recklinghausen und Münster sowie der Biologischen Station Kreis Recklinghausen in Lembeck.
Letztlich aber kooperierten alle gut miteinander, so dass das Vorhaben nach etwa 1 1/2 Jahr so richtig ins Rollen kam.
Zwischen dem Straßenbauamt und Herrn von der Warth wurde ein Vertrag abgeschlossen, der die Nutzung der Weide regelt. Die Fläche wurde neu eingezäunt und im September 1996 gemäht. Das Mähgut, das zum großen Teil aus Disteln bestand, wurde zum überwiegenden Teil abgefahren, auch Weiden, die bereits zu groß waren, um von den Rindern verbissen zu werden, wurden gefällt, Dadurch wurde den Rindern eine gute Ausgangsposition ermöglicht. Außerdem wurde noch ein Unterstand für die Rinder gebaut, um damit bereits im Vorfeld gegen die zu erwartenden Attacken der Tierschützer („Wie kann man die armen Tiere nur im Winter draußen stehenlassen“???) gewappnet zu sein. Aus tiermedizinischer Sicht wäre dieser Unterstand jedoch nicht notwendig gewesen, da die Tiere äußerst robust sind.
Im Oktober war es dann soweit: mit Hilfe des NABU Dorsten und unter Beteiligung eines Kamerateams des Westdeutschen Rundfunks wurden die sieben Heckrinder in Gahlen-Östrich mit großen Mühen und vielen (erfolglosen) Versuchen eingefangen, verladen und nach Hervest gebracht.
Mit großen Sprüngen ging es vom LKW in die neue Heimat, wo sich die Rinder sichtlich wohlfühlten. Sofort machten sie sich daran, die große weite Flächen zu erkunden und ihr Territorium abzustecken.
Die Besiedlung der Ausgleichsfläche mit Heckrindern fand bald ein riesiges Interesse bei Fernsehen, Zeitungen und Rundfunk.
Entwicklung der Ur-Viecher im Hervester Bruch
Bereits im Frühjahr stellte sich erster Nachwuchs ein, als drei Kälber geboren wurden. Zusätzlich waren bereits im Februar 1997 noch drei weitere weibliche Tiere aus dem Tierpark Stendal hinzugekauft worden.
Auf Anregung des NABU Dorsten wurde auf der Südseite des Gebietes in Kooperation mit der Unteren Landschaftsbehörde und der Biologischen Station Recklinghausen eine Aussichtskanzel gebaut, von der aus der interessierte Bürger und Naturfreund einen guten Überblick über das weitläufige Areal erlangen kann.
1998 kamen weitere fünf Kälber zur Welt. Zum Winter hin wurden jedoch zehn Tiere verkauft, um die Herde nicht beifüttern zu müssen. Von Anfang an sollte der Bestand an Rindern nur so groß sein, dass die Tiere ohne zusätzliche Nahrung in Form von Kraftfutter o.ä. durch den Winter kommen können.
Anfang des Jahres 1999 erblickten acht Kälber das Licht der Welt, so dass eine mittlerweile recht stattliche Herde versucht, eine halboffene, artenreiche Landschaftsstruktur zu erhalten, zu gestalten und neu zu formen.
Nicht nur Fauna und Flora profitieren von der Weidetätigkeit der „Ur-Viecher“, wie sie derweil liebevoll von den Hervestern genannt werden, nein, sie haben sich trotz aller Kritik in der Anfangszeit zu einem echten Sympathieträger gemausert.
Ihr wehrhaftes Erscheinungsbild, das uns unbewusst schaudern lässt, ist eine Bereicherung für den Beobachter im Hervester Bruch. Beim geruhsamen Betrachten der Herde erlebt der Mensch einen Hauch dessen, was bereits unsere steinzeitlichen Vorfahren beim Anblick der mächtigen Körper, der glänzenden Hörner und dem lauten Schnauben des Leitbullen verspürt haben mögen – mit dem Unterschied, dass es in der Steinzeit keine Zäune gab, die den Menschen vor der Ur-Kraft schützen konnten.
Wir hoffen, dass die neue Ur-Zeit in Hervest ewig dauert und dieser Aufbruch in eine neue Form des Naturschutzes, der die Pflege großer Flächen in Zeiten knapper Finanzen möglich macht, rund um Dorsten und darüber hinaus viele Nachahmer findet.
Die Grille laut im Grase zirpt, der Auerhahn um Bräute wirbt.
Hochzeiten gibt es überall, nur abgestuft von Fall zu Fall.
So menschlich ist die Kreatur, dass wir sie gern und oft hofieren;
nur sollte dabei die Natur nicht sinnlos ihr Gesicht verlieren.
Rudolf Boden
Hans Rommeswinkel
Streuobst im Stadtraum
Die Stadt Dorsten hat Ende der 80er und zu Beginn der 90er Jahre gezielt damit begonnen Streuobstwiesen neu anzulegen. Zunächst waren es klassische Maßnahmen des Natur- und Umweltschutzes zur Verbesserung der Biodiversität im Stadtgebiet. Einige örtliche Schulen und der NABU haben Pflanzungen unterstützt und ebenfalls alte hochstämmige Obstbäume besonders im südlichen Stadtraum gepflanzt. Im Zuge der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelungen wird diese Maßnahme der Neubegrünung von Streuobstwiesen an den Baugrenzen von Neubaugebieten genutzt. Die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung bedeutet, dass bei Eingriffen in Natur und Landschaft nach einem Bewertungssystem die Schwere des Eingriffs bewertet und demzufolge der Ausgleich als sogen. Kompensations-maßnahme zum Beispiel durch das Anlegen einer Streuobstwiese erfolgen kann. Der Siedlungsrand wird somit in aufgelockerter Form gefasst und gelichzeitig bieten sich ökologische und soziale Funktionserfüllungen. Ein solches Beispiel kann gut am Schlehenweg in Rhade erkundet werden. Die Menschen entdecken diese alten Fruchtsorten oder es werden alljährlich Äpfel gesammelt und bei der Biologischen Station zu Saft verarbeitet. Aber nicht nur Apfelsorten wurden und werden gepflanzt sondern auch Birnen-, Kirsch- und Pflaumenbäumen. Diese alten Obstsorten sind im Zuge der modernen Flächennutzung und geringen Pflege der Fruchtbaumbeständen aus der bäuerlichen Feldflur verloren gegangen. Die landschaftsökologische Bedeutung der locker mit hochstämmigen Obstbäumen überstellten Wiesen ist sehr hoch, was zahlreihe Untersuchungen und Kartierungen von Tier- und Pflanzenarten belegen.
Mitte der 90er Jahre wurde die Idee in der Verwaltung geboren Brautleuten eine Möglichkeit zu bieten, einen „Hochzeitsobstbaum“ zu pflanzen. Die Verwaltung bietet dazu einen jährlichen Pflanztermin mit den Brautleuten an. So wurden im Stadtgebiet verstreut bis zur heutigen Zeit hochstämmige Streuobstwiesen als „Hochzeitwäldchen“ angelegt. Die erste dieser Fläche liegt an der Wiese nördlich der Sekundarschule in Holsterhausen. Es sind über hunderte von Bäumen von Brautleuten gespendet und selbst gepflanzt worden! Allein in den letzten 2 Jahren bis heute werden über 90 solcher Bäume gepflanzt und mittlerweile gibt es in fast jedem Stadtteil öffentlich zugängliche Streuobstwiesen. Die Pflege trägt der Betriebshof Grün des Tiefbauamtes der Stadt oder wie in Lembeck und Deuten die örtlichen Heimatvereine. Mittlerweile erfolgen auch gezielte Kronenschnitte zur Erhaltung der Bestände. Der Aufwand ist nicht unerheblich und es gibt Paten zur Unterstützung wie z. B. der örtliche Jagdhegering der Herrlichkeit Dorsten.
Aktuell wird auch erörtert, ob es auch andere fruchttragende Gehölzanpflanzungen für Geburten und Brautleute geben kann, da die Verfügbarkeit von größeren Flächen zum Neuaufbau der Streuobstwiesen erschwert ist.
Sabine Fischer-Strebinger
Streuobstwiesen bieten eine hohe Attraktivität für Erholungssuchende, Dorstener und Touristen
m Frühjahr gehören blühende Streuobstwiesen sicherlich zu den schönsten Ausflugszielen in der Natur. Von Mitte April an zeigen die Bäume ihre Blütenpracht, beginnend mit der Kirschblüte. Darüber hinaus tragen die Blumen auf den Wiesen zur bunten Farbenpracht bei.
Eigentlich wurden Obstbäume früher an landwirtschaftlich weniger nutzbaren Standorten gepflanzt, verschwanden infolge der Intensivierung der Landwirtschaft im 20. Jahrhundert und sind inzwischen auch aus Gründen des Naturschutzes wieder ein wichtiges Thema.
Für das Stadtgebiet Dorsten gibt es eine Erfassung der öffentlich oder teilweise öffentlich zugänglichen Streuobstwiesen, die in diesem Buch anhand einer Karte dargestellt sind. Die Dorstener Streuobstwiesen laden zu einem Ausflug durch das Stadtgebiet ein. Wer gerne wandert oder mit dem Rad in der Natur unterwegs ist, kennt sicherlich schon einige Streuobstwiesen unserer Stadt. Warum nicht mal im Frühling eine Blütenrundfahrt starten. Fahrten und Wanderungen entlang der Streuobstwiesen sind bis in den Herbst hinein möglich und auch in der kalten Jahreszeit haben die Streuobstwiesen viel zu bieten, insbesondere aber ihre Produkte. Im Winter brauchen die Bäume z.B. einen Schnitt und die Biologische Station in Lembeck, die Volkshochschule Dorsten und der RuhrKulturGarten in Altendorf-Ulfkotte bieten Kurse für Interessierte zum richtigen Baumschnitt an.
Auch Führungen werden von den Besitzern einiger Streuobstwiesen angeboten. Je nach Ort erhalten die Besucher Informationen über die Obstbäume, die Sortenwahl, die Pflege, Insekten, geschützte Tierarten oder die biologische Vielfalt. Auch die Verarbeitungskette hat für den Streuobstwiesenbesucher viel Interessantes zu bieten. Viele leckere Gerichte und Getränke lassen sich aus Äpfeln, Birnen, Nüssen, Mirabellen und Beeren zaubern und die kulinarischen Produkte der Streuobstwiesen werden in Hofläden angeboten und dürfen verkostet werden. Die Wiesen bieten zu jeder Jahreszeit ein reiches Angebot an Köstlichkeiten.
Seit 2018 lebte im Raum Schermbeck/Hünxe die Wölfin Gloria, später auch mit ihrem Nachwuchs in einem Rudel. Von Naturschützern als Rückkehr einer der für den Artenschutz wichtigen Prediatoren begrüßt, war die Zuwanderung der Wölfe von Beginn an in Teilen der Bevölkerung hoch umstritten, da es immer wieder zu Rissen von Nutztieren kam. Ein Abschuss der Wölfe wurde allerdings gerichtlich untersagt. Seit Frühjahr 2025 sind Gloria und ihr Rudel verschwunden. Über das Verbleiben der Tiere gibt es keinerlei Anhaltspunkte. Annerose Scheidig hat dieses umstrittene Kapitel im Artenschutz aus ihrer persönlichen Sicht thematisiert:
Annerose Scheidig
Hurra, der Wolf ist da
Es läuft der Wolf um Mitternacht
im tiefen Wald umher.
In seinem wunderschönen Glanz,
der Mensch verehrt ihn sehr.
Der Gang wirkt edel, stolz der Kopf
und wachsam stets sein Blick.
Er traut sich auch am Tag hinaus,
streift Felder mit Geschick.
Er ist ein Teil aus der Natur,
solange war er fort.
Vertrieben!, keiner weiß warum,
aus diesem schönen Ort.
Es grasen Schäfchen tagelang –
die Weide grün und satt.
Der Schäfer Erwin liebt sie sehr,
Geburten fanden statt.
Die Lämmer niedlich, wunderbar,
sie blöken immerzu.
Ich könnt hier stehen stundenlang –
viel Leben und doch Ruh.
Und dann wird dieses Bild zerstört,
der Wolf verbreitet Not.
Er jagt das schwache Vieh gezielt,
zerreißt und beißt es tot.
.
Betrübt zieht Schäfer Erwin heim:
„Das war’s, das steht jetzt fest!“
Hurra, hurra, der Wolf war da!
Das gab ihm nun den Rest…
